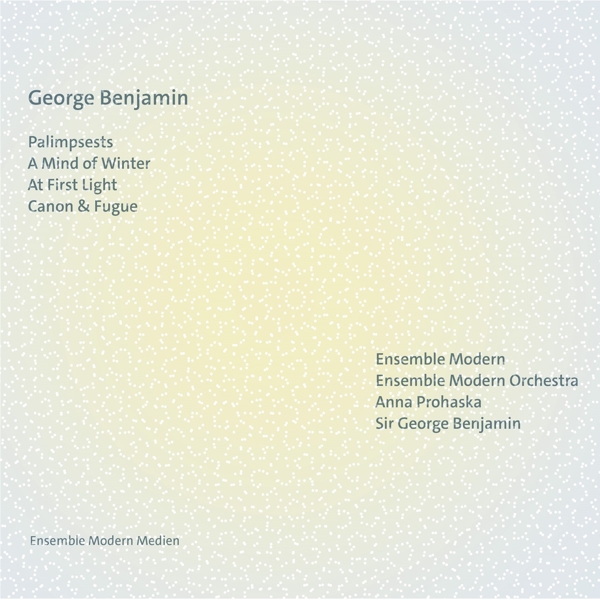Erstmals betritt ein wirklich perverser Wüstling in Monteverdis letzter Oper die Bühne der seinerzeit noch jungen Gattung des Musiktheaters: Kaiser Nero ist dieser gänzlich hormongesteuerte Unhold, der auf dem Weg zum nächsten Objekt seiner Begierden, der titelgebenden, am Ende zur Kaiserin gekrönten Poppea, auch mal über Leichen geht. Doch wie kommentiert Monteverdi das Zustandekommen dieser durch Sexus und Machtlust gleichermaßen motivierten Verbindung? Er schreibt ein so überströmendes Duett zweier Liebender, dass man dahinschmelzen will. Die vielleicht sogar Ewigkeit verheißende Chaconne mit ihrem durchlaufenden Walking Bass dient dem Meister aus Mantua für diesen innigen Gesang zweier gleichschwingender Seelen. Schönheit und Wahrheit des Gefühls gehen da Hand in Hand. Nur der Moral, den klassischen Kategorien von Gut und Böse scheint dieses tränentreibende Finale wie enthoben. Hebelt die Liebe jeden Anstand aus? Ist sie größer als Gesetze, größer als die Institution Ehe?
Hemmungsloser hormoneller Hedonismus
Monteverdi und sein kongenialer Textdichter Giovanni Francesco Busenello huldigen in ihrem Meisterwerk einem hemmungslosen hormonellen Hedonismus, der später, im verstandesmäßig eingehegten Zeitalter der Aufklärung, ein Unding werden sollte. Hier ist dieser Hedonismus, diese ungezügelte Feier des Lebens, noch das Maß aller Dinge. Eva-Maria Höckmayr hat das mit ihrem Regieteam unglaublich genau verstanden – und wunderbar feinfühlig in die Inszenierungstat umgesetzt. Was sie denn auch überhaupt nicht nötig hat, ist es, auf Jens Kilians leergeräumter Bühne sensationsheischend allerhand Sexorgien zu veranstalten. Höckmayr setzt stattdessen auf feinfühlige Präzision der Personenführung, viel Ruhe, tänzerische Unmittelbarkeit und gegenseitiges Beobachten. In einem Gesellschaftssystem, das alles erlaubt, muss sich schließlich auch niemand verstecken. Die Travestie ist hier auf einmal das Natürlichste von der Welt, ein flotter Dreier ebenso: Erlaubt ist, was gefällt.

Monteverdis erotische Gesellschaft, oder: Erlaubt ist, was gefällt
All dem über drei zauberhafte Stunden beizuwohnen, ist im Ergebnis auf unspektakuläre Weise spektakulär, es verleiht den Figuren auf liebevoll einfühlsame Weise Fleisch und Blut. Man mag an diesem Abend der vollkommenen Opern-Erfüllung an die Kunst der Verdichtung eines Peter Brook denken, in jedem Fall an die Regie-Könner längst vergangner Zeiten der Oper, als aktionistisches und auf Teufel komm raus aktualisierendes Aufpeppen alter Geschichten noch kaum ein Regisseur nötig hatte. Monteverdis erotische Gesellschaft wirkt in den herrlich üppigen, berückend bunten Kostümen des Frühbarock, die Julia Rösler entworfen und fast unmerklich mit Versatzstücken der Gegenwart mischt, ganz verblüffend sympathisch. Alles ist erotische Poesie in diesem geschlossenen Bühnensystem eines goldenen Bandes, das vom Bühnenboden bis zu einer himmelwärts strebenden Tapete reicht. Dieses Band kann allerhand Farben annehmen. Schließlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Momente der Desillusionierung werden in kaltes Silber getaucht. Der karnevaleske Fummel der Figuren hebt sich immer wieder funkelnd von diesem Hintergrund ab.

Gewürzt mit den köstlichen Spezereien der Barockküche
Die szenische Stimmigkeit und traumwandlerische Genauigkeit wird freilich von der musikalischen noch übertroffen. Diago Fasolis treibt mit der Akademie für Alte Musik Berlin nicht einfach nur maximal motivierte Historische Aufführungspraxis. Er begegnet Monteverdi gleichermaßen respektvoll wie respektlos: Denn er hat die Partitur mit allerhand Spezereien von Zeitgenossen des Meisters aus Mantua gewürzt, zumal mit Musik von Monteverdis Schüler Cavalli und allerhand tänzerisch hochfliegendem Schlagwerk. So erhält der Abend extra scharfe Hörwerte, musikantischen Witz und plötzliche Überraschungen eines Pasticcio. Auch Diego Fasolis› undogmatischer Ansatz bestätigt das Handlungsmotto des Werks: Erlaubt ist, was gefällt.
Das Liebesluder Poppea kann man kaum besser besetzen

Sängerisch besser besetzen lässt sich ein Monteverdi derzeit wohl kaum. Anna Prohaska darf als Poppea die einzig dezidiert heutige Figur spielen: ein voll emanzipiertes, blitzgescheites Luder der Liebe, da ihrem liebestollen Nero haushoch überlegen ist. Großartig gestaltet Prohaska mit vielen aufregend gerade gezogenen Tönen jede Nuance ihres Parts. Zwei der besten Countertenöre unserer Zeit stehen ihr zur Seite: Max Emanuel Cencic als viril durchdringender, angenehm scharf charakterisierender, sehr dramatischer Nerone und Xavier Sabata als herzweichend warm und weich intonierender, fein lyrischer Ottone, der mit seinem Timbre und seiner Stimmgebung wie aus Ebenholz für die schönsten Töne des Abends sorgt. Die schönsten Noten des Abends darf gleichwohl sein Kollege Cencic singen: Im Schlussduett mit Poppea, von Fasolis in utopischer Dehnung auf die Affektspitze getrieben, wird die Liebe so innig schön besungen wie auch dreihundert Opernjahre später nie wieder. Ein Abend für die Geschichtsbücher.
Staatsoper unter den Linden Berlin
Monteverdi: L’Incoronazione di Poppea
Diego Fasolis (Leitung), Eva-Maria Höckmayr (Regie), Jens Kilian (Bühne), Julia Rösler (Kostüme), Max Emanuel Cencic, Katharina Kammerloher, Anna Prohaska, Xavier Sabata, Franz-Josef Selig, Evelin Novak, Gyula Orendt, Linard Vrielink, Florian Hoffmann, David Ostrek, Lucia Cirillo, Narine Yeghiyan, Jochen Kowalski, Mark Milhofer, Akademie für Alte Musik Berlin