Als Pierre Boulez 1967 vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel zur Zukunftsfähigkeit der Oper befragt wurde, antworte der französische Meister einer intellektuell pointierten Neuen Musik mit jugendlich bissigem Geist, es sei seit Alban Bergs „Lulu“, die der Komponist mit seinem Tod 1935 unvollendet hinterließ, „keine diskutable Oper mehr komponiert worden“. Um seine vernichtende Diagnose zu untermauern, bekamen auch die Opernhäuser ihr Fett weg: „In einem Theater, in dem vorwiegend Repertoire gespielt wird, da kann man doch nur mit größten Schwierigkeiten moderne Opern bringen – das ist unglaubwürdig. Die teuerste Lösung wäre, die Opernhäuser in die Luft zu sprengen.“ In den Ansätzen seiner Kollegen Maurizio Kagel und György Ligeti sah er immerhin eine „Quelle für eine Vision des neuen musikalischen Theaters. Doch besonders Kagel und Ligeti mangelt es an umfassender Theaterkenntnis. Und manchmal ist die musikalische Seite recht dünn“.
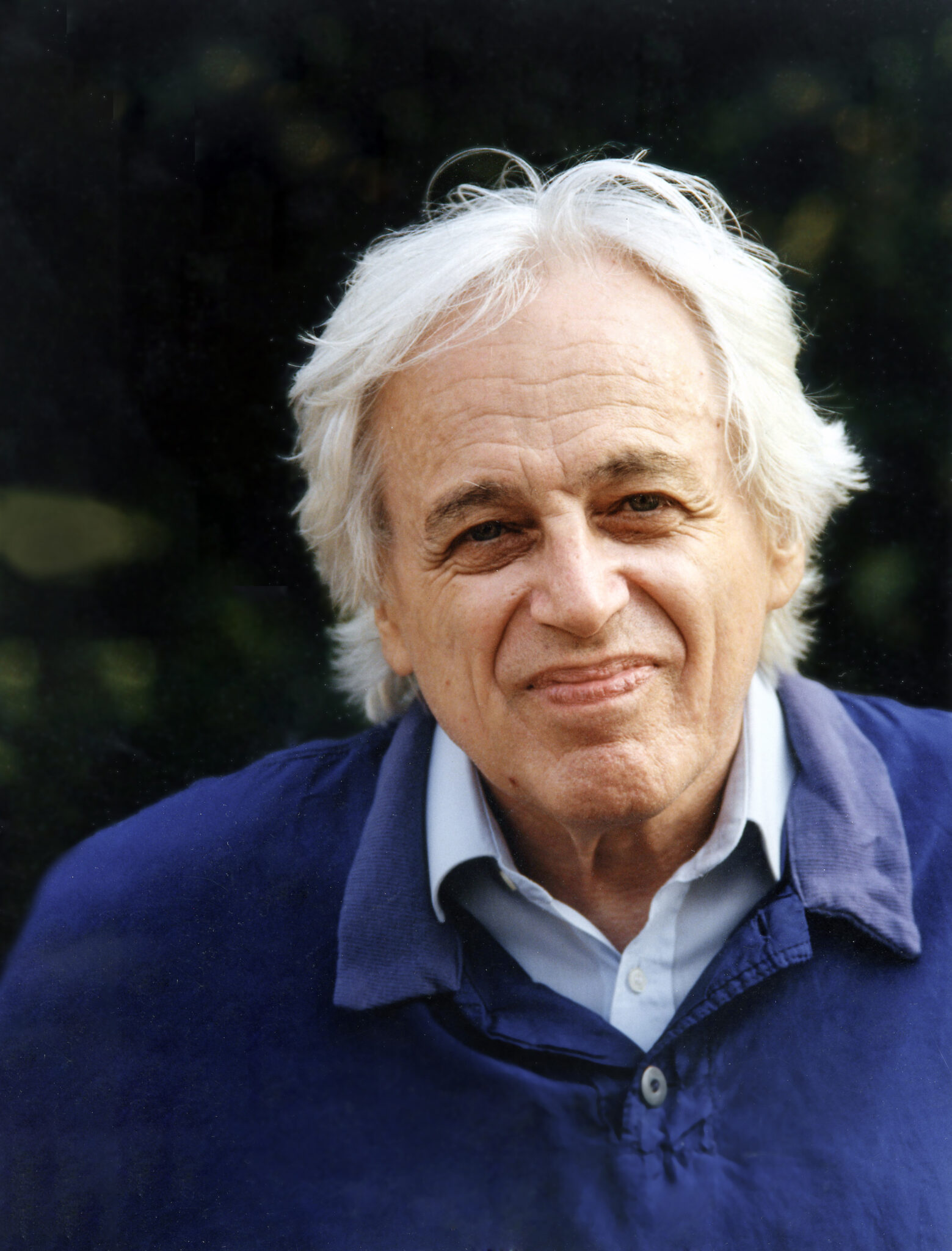
Zuerst sollte Kagel seinen Mitstreiter widerlegen, als er 1971 die Hamburgische Staatsoper mit einem Riesenskandal aufmischte: Sein Staatstheater stellte die Oper als Institution in Frage, thematisierte deren Absurditäten, war – mit historischem Abstand betrachtet – aber doch auch eine heimliche Liebeserklärung an die Kunstform. Dann legte Ligeti 1978 in Stockholm nach. Mit „Le Grand Macabre“ wollte er sich vom Schatten der sinfonisch-spätromantischen Operntradition von Wagner und Strauss ebenso lösen wie von den Dogmen der Avantgarde. Die musikdramatische Konzeption sollte sich eher an Verdis „Falstaff“ oder Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ annähern. Meilensteine eines komischen Musiktheaters also inspirierten ihn zu einem listig-lustigen Opernzugriff: „Bühnengeschehen und Musik sollten gefährlich, bizarr, ganz übertrieben, ganz verrückt sein.“ Herausgekommen ist dann, wie Ligeti sich ausdrückte, eine „Anti-Anti-Oper“ – die dialektische Volte einer Affirmation durch Negation schlagend.
„Le Grand Macabre“ – eine grandiose Groteske
Abgehoben philosophisch geht es in dem theatersaftigen Stück nicht zu, schließlich verfolgt sein Schöpfer die „Idee des hyperfarbigen, comicartigen musikalischen und dramatischen Geschehens“. Er lässt den Tod tanzen. Doch der grinst gern bis über die Ohren. Der dem Werk seinen Namen gebende Große Makabre will die Welt mit Hilfe eines Kometen vernichten. Die grandiose Groteske, die Ligeti nach der Vorlage des flämischen Dramatikers Michel de Ghelderode schuf, lässt offen, wer in diesem absurden Theater der personifizierte Tod wirklich ist. Bloß ein charismatischer Gaukler, der all den schrägen Gestalten des verhurten Breughellands einen höllischen Schrecken einjagen will? Ein manipulativer Taschenspieler, der mit den allzu menschlichen Ängsten spielt? Ein demagogischer Scharlatan-Verführer, der dem verblödeten Volk jede Lüge auftischen kann?
Plumpe politische Aktualisierungen würden der Anti-Anti-Oper kaum guttun. Dementsprechend haben zwei herausragende Inszenierungen der letzten Jahre den Spieltrieb entfesselt und zum Thema gemacht. Herbert Fritsch lässt 2017 am Luzerner Theater Grimassieren, Gegen-die-Portalwand-Knallen und In-den-Bühnenabgrund-Fallen aufeinanderprallen. Als Experte des Absurden weiß Fritsch des Meisterwerks Prinzip von Lust und Drang zu nutzen. Martin G. Berger stellt uns den Makabren in seiner Neuinszenierung von 2021 am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin als Avatar vor, der in staksigem Gang aus einem Videospiel heraus- und in die Opernhandlung eintritt. Möglich macht dies das spätpubertierende Söhnchen von Domina Mescalina und ihrem spießigen Astronomengatten Astradamors. In seinem Kinderzimmer sehnt sich der Knabe angesichts einer hyperkomplex gewordenen Welt nach den einfachen Antworten seiner Comic-Heroen. Alsbald mischen sich die Ebenen aus Videos, Opernhandlung und teilnehmenden Beobachtern. Denn die Raumbühne entführt das Publikum ins Varieté der 1920er Jahre. Der multimediale Overkill ist perfektes Abbild einer Partitur, die einer im flinken Filmschnitt gebauten postmodernen Ästhetik der sprunghaften (Pseudo-)Zitate folgt und die Gattung spöttisch durch den Kakao zieht. So gaga die Gags sind, so sehr ist Ligetis schrilles Stück eine Steilvorlage für durchgeknallte Inszenierungskonzepte. Ligetis runder Geburtstag ist dazu willkommener Anlass.





