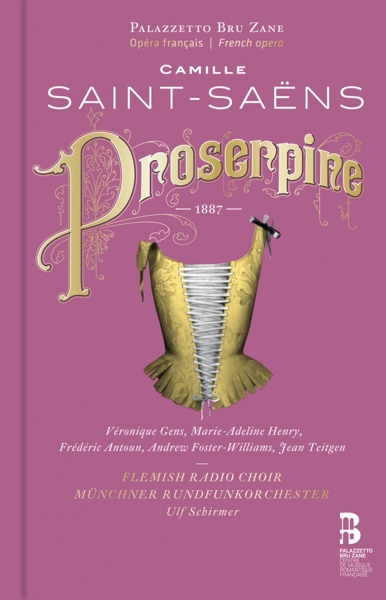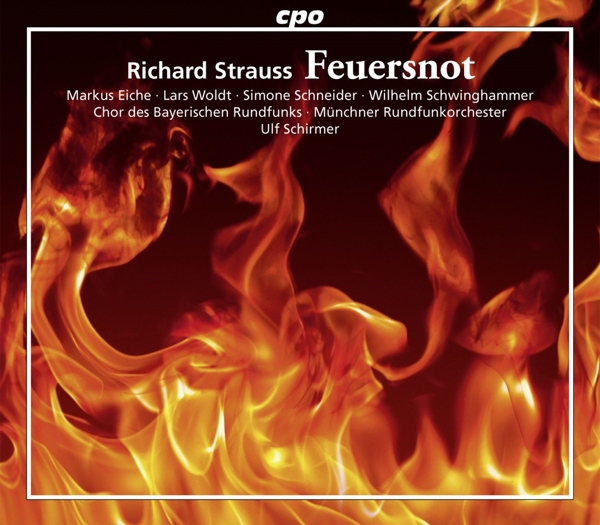Noch einige Wochen vor Ausbruch der Coronakrise sah es aufgeräumt aus im großen, sonnigen Intendantenzimmer der Oper Leipzig. In einer Zeit, da sich niemand vorstellen konnte, wie extrem die gesellschaftliche Tiefkühlung die gesamte Kultur treffen würden, gab der Leipziger Opernintendant Ulf Schirmer ein durchaus zuversichtliches Interview. Auf dem Flügel lagen einige Partituren, daneben waren auf einem Plakatständer fernöstliche Schriftzeichen aufgemalt. Sucht Ulf Schirmer Kontemplation, lernt er Japanisch – als Vorbereitung für seinen Ruhestand ab 2022. Ruhig und aufgeräumt wirkte damals auch die Oper selbst, nachdem der Dirigent 2009 zum Generalmusikdirektor und 2011 zusätzlich zum Intendanten berufen wurde an ein Haus, das bis dahin recht stürmische Zeiten erlebt hatte.
Im übernächsten Jahr endet Ihre Amtszeit in Leipzig. Was haben Sie dann vor?
Ulf Schirmer: 2022 werde ich die Leipziger Doppelfunktion dreizehn Jahre ausgefüllt haben. Das ist eine Last, die ich gerne trage, die aber wirklich dann auch mal enden muss, damit ich mich ganz aufs Dirigieren konzentrieren kann.
Wie haben Sie diese Doppelaufgabe bisher tragen können?
Schirmer: Nur in Zusammenarbeit mit der guten Belegschaft. Ich sehe vor allem den Vorteil, meine künstlerischen Vorstellungen selbst umsetzen zu können. Und ich bin auch nur hier – Gastdirigate in anderen Städten so wie früher kann ich mir kaum erlauben.
Gibt es ein Projekt, auf das Sie sich danach besonders freuen?
Schirmer: Ich plane zum Beispiel eine Publikation und Vorträge über die „Alpensinfonie“, die ich schon oft dirigiert habe. Sie ist eines der am meisten unterschätzten intellektuellen Werke von Richard Strauss. Es gibt da sehr viele Bedeutungsebenen unter der bloßen Naturbeschreibung: Das sind alles Metaphern, die wiederum etwas anderes verbergen. Strauss hat das nie sonderlich veröffentlicht, aber ich möchte es für mich klarstellen und mich entfernen von dem verkitschten Heimatfilm-Alpenbild. Solche Projekte, die jetzt noch alle ruhen, brauchen natürlich viel Zeit, und die kann ich mir dann nehmen.
Bis es so weit ist, haben Sie in Leipzig noch einiges vor. Der Erfolg Ihrer Vorgänger fiel, vorsichtig ausgedrückt, sehr unterschiedlich aus. Was machen Sie anders?
Schirmer: Als ich angefangen habe, hatte ich einen Plan, was das Publikum braucht, das dafür auch wissenschaftlich befragt wurde. Mit diesem Gepäck sind wir alle losmarschiert und nie von unserem Plan abgewichen. Man braucht Beharrlichkeit, Geduld und Konsequenz. Ich glaube, diese Art von Konstanz ist wichtig, damit das Publikum nach einer gewissen Zeit merkt, dass es sich auf die Oper Leipzig verlassen kann. Keine Schnellschüsse, kein Aufspringen auf irgendwelche Moden. Außerdem wurde die Oper zum Repertoiretheater umgebaut, soweit das mit den personellen Möglichkeiten machbar war.
Das Interesse am Publikum war nicht allen Vorgängern gegeben.
Schirmer: Es gibt da verschiedene Haltungen dem Publikum gegenüber. Ein Kollege von mir meinte sogar öffentlich, man müsse es erziehen. Da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Ich möchte es erreichen, mit ihm im Dialog sein. Das geht nicht immer reibungslos, aber es braucht dieses Grundvertrauen, damit das Publikum auch mitgeht. Es gab bei den alteingesessenen Abonnenten zum Beispiel große Vorbehalte gegen Alban Bergs „Lulu“. Sie kamen dann trotzdem, weil ich das Stück so unbedingt empfahl, und waren begeistert. Aber das ist ein Prozess: Ich kann nicht heute damit anfangen, und morgen kommen die Leute. Menschlicher Dialog dauert. Das habe ich versucht.
Nach innen scheint das Haus befriedet, auch das war nicht immer so.
Schirmer: Wir haben etwa 670 Mitarbeiter, manchmal auf geteilten Stellen. Ich glaube, die Doppelfunktion hat ihnen eine gewisse Sicherheit gegeben, weil der Verwalter wusste, wohin der Künstler will und umgekehrt. Sehr wichtig war mir auch von Anfang an, Regisseure fernzuhalten, die das ganze Haus verrückt machen, weil sie auf der Bühne von der großen Humanitas schwadronieren und sich in den Proben wie kleine Diktatoren aufführen. Unser Personal muss sich nicht angegriffen fühlen, nur weil es arbeitet.
Wählen Sie alle Regisseure selbst aus oder in Zusammenarbeit mit der Dramaturgie?
Schirmer: Manchmal besetze ich im Alleingang am Betrieb vorbei – das sind auch wichtige Signale –, meistens aber in der Diskussion mit der Operndirektion und Dramaturgie. Wir haben auch keinen Hausregisseur mehr, denn der müsste ja mindestens zwei Inszenierungen verantworten. Wenn wir nur wie derzeit fünf Opernproduktionen im Jahr machen, ist mir der Schnitt zu hoch, weil die Handschrift dann zu einseitig wird. Die drei Ballettpremieren sind ja ohnehin ein anderes Terrain.
Sie haben den Output der Oper von vier auf fünf Produktionen gesteigert. Warum können andere Häuser mehr schultern?
Schirmer: Zuerst ist das eine Frage des Personals. Wir wollten zum Beispiel die wunderbare „Rusalka“ aus Chicago kaufen, konnten das aber nicht, weil diese Produktion 47 Bühnentechniker benötigt und wir in der Spitze nur 27 zur Verfügung haben. Dann gibt es nur eine begrenzte Zahl von Diensten der Gewandhausmusiker. Wenn Sie eine Wagneroper aufführen, sind das wegen der Stücklänge gleich zwei Dienste. Allein für die Aufführung eines kompletten „Nibelungenrings“ brauchen Sie also schon sieben Dienste – und da haben Sie noch keine einzige Probe gemacht. Zum dritten spielt auch die finanzielle Ausstattung eine Rolle. Die fünfte Premiere kann nur stattfinden, weil sie fremdfinanziert ist.

Den Bedarf für mehr gäbe es aber?
Schirmer: Da sind wir nicht sicher. Man kann das nicht mit DDR-Zeiten vergleichen, als die Oper mit ihren damals mehr als 1000 Stellen fast täglich spielte – da war das Haus allein durch Abonnenten und gut organisierte Betriebsausflüge gefüllt. Wir haben sehr viel experimentiert. Immer aber versuchen wir, und das ist sicher ein Teil des Erfolgs, auf das Publikum, auf den Markt zu reagieren. Machen wir nur eine kleine Serie und damit neugierig und wiederholen dann lieber in der nächsten Saison? Alles haben wir durchexerziert, den Stein der Weisen aber noch nicht gefunden.
Leipzig gehört zu den wenigen wachsenden Städten im Osten. Merken Sie das an der Auslastung?
Schirmer: Auf jeden Fall! Wir haben ja die Zahlen kontinuierlich gesteigert, mittlerweile sind wir bei über 76 Prozent Auslastung – Tendenz steigend. Und die wachsende Einwohnerzahl wird sich natürlich hoffentlich auch weiter auf unser Publikum auswirken.
Was muss ein Stadttheater leisten?
Schirmer: Die Ausrichtung hat immer damit zu tun, woher das Geld kommt. Mein Publikum sind die Leipziger, die sich dieses Theater leisten. Eine Staatsoper wie in Wien hat strukturell ganz andere Aufgaben. Hier müssen wir uns auf die Bevölkerung konzentrieren, nah dran sein, Jugendarbeit machen.
Wie in den Nachbarstädten haben auch Sie einen kompletten „Ring“ im Programm. Gehört Wagner besonders nach Leipzig?
Schirmer: Vor allem deshalb, weil er hier vorher nicht sehr verankert war, besonders zu seinen Lebzeiten. Die Ablehnung der „Feen“ im Alter von zwanzig Jahren kränkte ihn tief – deswegen haben wir sie gleich zu Beginn meiner Amtszeit einstudiert –, und Wagner kam außer für familiäre Treffen kaum nach Leipzig. Das ist ein ähnlich unterkühltes Verhältnis wie zwischen Strauss und Garmisch. Aber Richard Wagner gehört hierher, weil er in Leipzig sozialisiert und musikalisch ausgebildet wurde.
Sie dirigieren viele seiner Werke selbst. Sind Sie ein Wagnerianer?
Schirmer: Nein. Denn dazu würde auch gehören, sein theatralisches Weltbild und kritiklos die unsäglichen politischen Aussagen zu übernehmen, wobei diese sich auch je nach Stimmungslage sehr unterschieden. Aber seine Musik liebe ich sehr. Vielleicht darf man nicht erwarten, dass ein Theaterautor ein widerspruchsfreier Philosoph ist.
Neben einer ganzen Reihe von Strauss-Opern leisten Sie sich jetzt auch den „Sturz des Antichrist“ von Viktor Ullmann. Ist das nicht ein besonderes Wagnis bei über 1200 Plätzen?
Schirmer: Die Premiere ist ja eingebunden in mehrere Veranstaltungen unterschiedlichen Formats. Sie müssen mir das nicht glauben, aber ich interessiere mich für die Vorverkaufszahlen nicht. Es hat mehrere Gründe, warum wir ausgerechnet dieses Stück machen, das für die Wiener Staatsoper gedacht war und dann 1938 natürlich nicht mehr zur Uraufführung kam. Zum einen wollte ich prüfen, ob sich Ullmann als Repertoirekomponist eignet. Zum anderen muss ein Haus wie dieses auch solche Stücke machen.
In Leipzig fanden früher sehr viele Uraufführungen statt, auch unter Ihren Vorgängern, aber das Publikum goutierte das nicht.
Schirmer: Als Dirigent habe ich jahrzehntelang viel neue Musik gemacht. Wegen der Leipziger Vorgeschichte habe ich hier darauf lange verzichtet. Jetzt ist die Situation anders. Im Juni 2021 planen wir wieder eine Uraufführung: „Paradiese“ von Gerd Kühr.
Zur Oper selbst gehört in Leipzig noch die Musikalische Komödie für das heitere Fach. Sie sollte vor einigen Jahren noch geschlossen werden – nun wird das baufällige Haus saniert. Ein Gegenentwurf zur großen Oper?
Schirmer: Als ich in Leipzig anfing, wollte ich die Musikalische Komödie in den Fokus rücken, die bis dahin eher als Appendix begriffen worden war, was nicht zu rechtfertigen war, weil dort 120 Menschen auf sehr hohem künstlerischen Niveau arbeiten. Durch eine neue Personal- und Repertoirepolitik sind die Auslastungszahlen dort gigantisch. Als ein neues Funktionsgebäude errichtet wurde, wurde klar, dass auch das Theater von Grund auf renoviert werden muss. Im Herbst geht es wieder los.
In München haben Sie dereinst selbst viele Operetten dirigiert. In Leipzig nicht?
Schirmer: Darüber habe ich lange nachgedacht. 2021 werde ich an der Musikalischen Komödie ein Stück dirigieren. Welches das sein wird, verrate ich aber noch nicht.