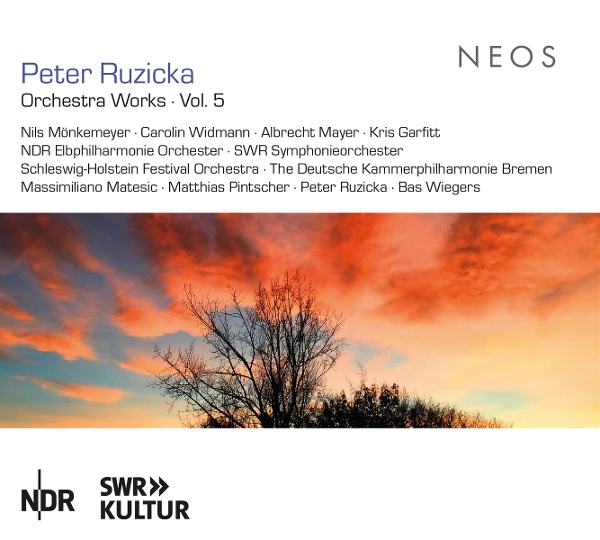„Beamter auf Lebenszeit“ – wann immer Nils Mönkemeyer die Worte in den Mund nimmt, schwingen gleichzeitig Ironie und Zufriedenheit mit. Einerseits ist der Bratscher nämlich Künstler durch und durch, der seinen Weg außerhalb vorgezeichneter Konventionen gegangen ist. Andererseits wirkt Mönkemeyer aber auch bodenständig und geerdet. Seit 2011 ist er Professor an der Münchner Musikhochschule, was ihm die eingangs erwähnte Stellung garantiert. Am Abend vor dem Interviewtermin war Mönkemeyer zu Gast bei einer Klassiksendung für Jugendliche.
Herr Mönkemeyer, Sie sind nicht nur Solist, sondern auch Lehrer. Wie ist Ihr Blick auf die kommende Generation der Klassikhörer?
Nils Mönkemeyer: Ehrlich gesagt habe ich ein Problem damit, wenn man sich auf Teufel komm raus der Jugend oder den jungen Erwachsenen anbiedert, wenn man sich bemüht, cool und hip zu wirken, obwohl man es selbst gar nicht ist. Das ist dann zwar nett gemeint, geht aber meiner Meinung nach gehörig an der Sache vorbei. Die große Herausforderung liegt darin, die Leute ins Konzert zu bringen. Wenn sie erst mal im Zuschauerraum sitzen, sind sie am Ende gar nicht so überfordert, wie man gemeinhin behauptet, denke ich.
Wie sind denn Sie selbst zur Klassik gekommen?
Mönkemeyer: Eigentlich ganz typisch für meine Generation: Mein Vater war Jazz-Gitarrist, hat auch mal klassische Gitarre studiert. Und weil beide Eltern musikinteressiert waren, gab es in unserem Haushalt reichlich Klassik und Jazz. Ich bin da also gewissermaßen reingewachsen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Liebe zur klassischen Musik an eine ganze Generation nur unzureichend weitergegeben wurde. Inzwischen gibt es Bestrebungen, das zu ändern, aber der Erfolg oder Misserfolg wird sich erst in zehn, fünfzehn Jahren zeigen. Aber da ist viel in Bewegung, es gibt tolle und interessante Projekte. Man muss auch Vieles einfach ausprobieren, dann wird man sehen.
Sehen Sie sich da als Musiker auch in der Pflicht oder ist es die Aufgabe der Veranstalter, dafür zu sorgen, dass die jüngere Generation vermehrt Konzerte besucht?
Mönkemeyer: Primär ist das in meinen Augen schon die Aufgabe der Veranstalter, aber die Musiker machen nun mal die Musik. Nehmen wir das Projekt „Rhapsody in School“: Die Idee dazu muss erst einmal entstehen und verwirklicht werden. Wie mein Besuch einer Schulklasse am Ende aber ausfällt, liegt an mir.
Wie gestalten Sie solche Klassenbesuche?
Mönkemeyer: Ich sorge für eine lockere Atmosphäre und mache den Schülern klar, dass es keine dummen Fragen gibt. Es mag sein, dass ihnen meine Musik erst einmal fremdartig erscheint, mit der Zeit aber öffnen sie sich mehr und mehr für das, was ich ihnen zeige.

Als Bratschenprofessor sind Sie sowohl Pädagoge als auch Solist. Ist es schwierig, diese beiden Disziplinen unter einen Hut zu bringen?
Mönkemeyer: Im Grunde unterrichte ich ja schon länger als ich solistisch spiele. Die beiden Disziplinen konkurrieren allerdings nicht miteinander, sondern bereichern sich vielmehr gegenseitig. Es gibt Unterrichtstage, die mich regelrecht inspirieren, weil ich dann mal nicht an mich selbst, sondern an meine Schülerinnen und Schüler denke. Das Schöne dabei ist, dass ich am Ende auch nichts anderes mache, als wenn ich mich auf ein Konzert vorbereite: Ich versuche, eine Systematik und Struktur in die Dinge zu bringen, jedoch nicht für mich, sondern für meine Schüler. Das wiederum hilft mir ungemein bei der Arbeit an meinem eigenen Bratschenspiel.
Sie können auf etwa zwanzig Jahre Lehrerfahrung zurückblicken. Haben sich Ihre Schüler und Studenten in all diesen Jahren verändert?
Mönkemeyer: Nicht die Studenten, aber ihr Bratschenspiel! Die Generation der Bratschen-Solisten ist noch sehr jung, das Niveau wird kontinuierlich besser, auch unser Selbstverständnis ist so weit von den Bratscherwitzen entfernt wie noch nie.
Ach, und ich hatte mir fest vorgenommen, das Thema Bratschenwitze zu umschiffen.
Mönkemeyer: Die sind auch nicht mehr zeitgemäß. Ich denke, das Orchesterspiel ändert sich sehr stark. Nicht nur die Bratscher, sondern generell die Streicher haben früher weicher, runder gespielt, weniger offensiv. Auch der einzelne Spieler hat im Orchester mehr Verantwortung als früher, was sich auf die Spielweise auswirkt, die viel solistischer ist als früher.
Woran liegt das?
Mönkemeyer: Es herrscht mehr Mut dazu, auf der Suche nach Neuem auch mal mit liebgewonnenen Gewohnheiten zu brechen. Da spielt natürlich das Internet eine große Rolle, das die Musiker global vernetzt. Früher hat man zum Beispiel in Deutschland ganz anders gespielt als in Frankreich, weil jedes Land seine eigene Schule und Spielkultur hatte. Heutzutage, wo etwa die russische Schule des Streichinstrumentenspiels nur noch ein paar Klicks entfernt ist, lösen sich diese Grenzen allmählich auf.
Nutzen Sie denn das Internet bei musikalischen Fragen?
Mönkemeyer: Klar! Nehmen wir zum Beispiel die Frage nach dem Vibratospiel: Da gibt es einen ganzen Blog dazu, der sich obendrein nur mit dem Vibrato der Romantik auseinandersetzt. In diesem Blog hat eine Holländerin Aufnahmezeugnisse von Kreisler, Ysaÿe und anderen Künstlern zusammengestellt samt Zeitzeugnissen und Berichten von Konzertbesuchern. In meiner Ausbildungszeit musste ich dafür noch in die Bibliothek gehen und war auf das Material angewiesen, das vor Ort war.
Heißt das, dass Sie bei der Einstudierung eines unbekannten Stückes erst mal ins Internet gehen?
Mönkemeyer: Das wiederum dann doch nicht. Das liegt aber daran, dass ich in dieser Phase ganz bewusst versuche, nicht auf das zu achten, was andere Musiker denken und spielen. Im Idealfall verhält es sich also so wie bei der Einstudierung einer Uraufführung, bei der man ja auch nicht auf die Erfahrungen anderer Interpreten zurückgreifen kann.
In diesem Jahr gibt es gewissermaßen eine weitere Uraufführung für Sie: Sie treten erstmals als Künstlerischer Leiter in Erscheinung, und das bei gleich zwei Festivals: dem Festspielfrühling Rügen und beim Kammermusikfestival Elysium.,
Mönkemeyer: Richtig, das wird ziemlich aufregend. Im Kleinen ist man als Solist ohnehin Künstlerischer Leiter, und zwar jedes Mal, wenn man ein Konzert- oder Tourneeprogramm zusammenstellt. Bei den Festivals ist es großartig, dass ich jetzt ein tolles Team hinter mir habe, ich musste also nicht alles alleine machen. Es ist sehr spannend, mal nicht einen Abend, sondern einen größeren Zeitraum zu planen und sich zu überlegen, was so ein Festivalerlebnis überhaupt ausmacht. Denn das Publikum besucht in aller Regel kein fest geplantes Einzelkonzert, sondern möchte mehrere Konzerte in gedrängter zeitlicher Abfolge besuchen.
Das klingt aber auch so, als müssten Sie sich mit vielen neuen Musiken und Kompositionen sowie Ihnen unbekannten Künstlern befassen …
Mönkemeyer: Beim zweiten Mal vielleicht. Die Idee oder den Wunsch, das zu machen, habe ich schon seit Längerem in mir herumgetragen. Insofern hatte ich ohnehin schon viele Ideen, die ich jetzt umsetzen kann.
Ihr Weg als Konzertbratscher war erfolgreich, obwohl noch immer die meisten Violaspieler im Orchester sitzen. Stand dieses Thema für Sie jemals zur Debatte?
Mönkemeyer: In Hannover habe ich eine Zeit lang in der NDR Radiophilharmonie gespielt. Das Orchesterrepertoire ist natürlich fantastisch. Es ist ein unglaubliches Gefühl, Mahler oder Tschaikowsky zu spielen und zusammen mit 90 Musikern gewissermaßen zu einer Person zusammenzuschmelzen. Das hat etwas Magisches. Aber genau das ist mir auch schwergefallen. Ständig hatte ich Angst, den Klang zu ruinieren, weil ich wieder mal nicht aufgepasst habe oder schlicht zu laut spiele. Irgendwann habe ich verstanden, dass ich einfach mehr Freiheit brauche. Da bin ich eben doch zu individualistisch.