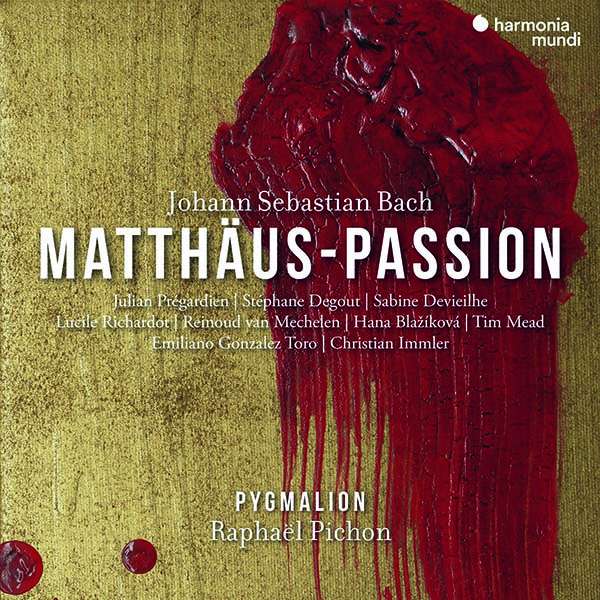Julian Prégardien: Superpünktlich rufen Sie an! Sie erwischen mich genau in der Mittagspause zwischen meinen Coaching-Sitzungen bei der Bertelsmann Stiftung!
Creating Careers heißt es dort auf der Website.
Prégardien: Ich bin nicht als Gesangslehrer engagiert oder als Vokalcoach, wie das im Neudeutschen heißt, sondern als Berater. Es gibt verschiedene Module in diesem Onlineprogramm. Alle Künstlerinnen und Künstler stellen sich ja mehr oder weniger regelmäßig die Frage: Wo stehe ich, was habe ich vor, wo brauche ich noch mehr Input, um mich weiterzubilden und besser aufzustellen oder während eines bestehenden Engagements mehr Aufmerksamkeit erregen zu können, um weitergehende Engagements zu bekommen. Natürlich unterhalte ich mich mit einigen Sängern über die Corona-Situation. Vorhin hatte ich eine sehr emotionale schwedische Sängerin vor mir, die sagte: ‚Jetzt mache ich nichts anderes als ein halbes Jahr zu üben und komme einfach nicht weiter‘. Wir alle merken, wie sehr uns das Auftreten vor Publikum und das kommunikative Element des Singens fehlt. Ich habe sie dann ermutigt – sie lebt vier Stunden entfernt von Stockholm – selbst Konzerte zu organisieren auf dem Land, in einer kleinen Kirche vielleicht mit einem Gitarristen. Diese Denkweise ist reinen „Opernsängern“ oft fremd.
Sie geben auch Hilfe zur Selbsthilfe?
Prégardien: Darin sehe ich eine Hauptaufgabe im Austausch mit Hilfesuchenden. Aber nochmal zum Auftreten: Es ist ein bisschen wie im Sport. Monatelange Wettkampfpausen sind schwierig für die Kondition und das mentale Gerüst. Im Endeffekt geht es bei uns dann nicht ums Gewinnen wie im Sport, aber eben darum, eine künstlerische Leistung, eine Performance, auf den Punkt vorzubereiten und zu präsentieren.
„P(anta) RHÉI: Alles bewegt sich fort und nichts bleibt“ heißt Heraklits kosmologischer Aphorismus, nach dem Sie 2016 Ihre Medienplattform für Aufführungspraxis nannten. Inwiefern beeinflusst ein alter Grieche Ihr Leben als Künstler?
Prégardien: Eine Essaysammlung des Komponisten und Musikphilosophen Hans Zender brachte mich während einer szenischen Produktion seiner „Winterreise“ in Luxemburg auf die Idee, besonders der Gedanke: „Wir steigen niemals in denselben Fluss“. Ich dachte mir, das müsste sich doch auch auf Musik übertragen lassen in Form eines Portals, das die Aufführungspraxis und Interpretationsgeschichte dieses Lied-Zyklus und auch anderer Werke aufschlüsselt. Franz Schubert und seine Freunde haben ja unter ganz anderen gesellschaftlichen und finanziellen Voraussetzungen Kunst gemacht als wir das heute wahrnehmen. Mich interessiert: Wie haben Menschen damals die Musik empfunden, wie heute? Wie ist die Erwartungshaltung an ein musikalisches Erleben? Und ich glaube, dies ist auch für das Publikum und auch für andere Interpreten interessant. Bei der Namensgebung für mein Projekt kam mir zunächst Heraklits „panta rhei» in den Sinn. Zusammen mit dem Akzent auf meinem Namen Prégardien kam ich dann auf den Titel „P.Rhéi».
Von einem Esperanto-kundigen Redakteur erfuhren Sie, dass „perei“ auf Esperanto auch die Bedeutung „zugrunde gehen» oder „vergehen» haben kann.
Prégardien: Tatsächlich! Doch das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Plattform derzeit stilllegen musste, da seit 2017 sehr viel Energie in meine Arbeit als Professor an der Hochschule in München fließt. Ich hatte die Plattform auch als ein zweites Standbein eingerichtet, als Spielzimmer für meine intellektuelle Beschäftigung mit den Werken und deren Interpretationen. Ich habe einfach keine Kapazitäten mehr, dies konsequent weiterzuführen. Aber interessant ist, dass meine dort präsentierte dreiteilige „Winterreise“ Edition, die es noch ganz altmodisch auf CD gibt, also nicht auf irgendeinem Streamingdienst, das einzige Einkommen neben meiner halben Stelle als Professor in den ersten Corona-Monaten war. Ich habe mir damit meine eigene Corona-Soforthilfe organisiert, habe CDs eingetütet und versendet. Ich bin auf sehr großzügige Menschen gestoßen, die gleich zehn Winterreise-Tryptichons gekauft haben. P.RHÉI lebt weiter, und zwar in mir selbst als Interpret und als Professor. Denn mein künstlerischer Anspruch bleibt. Nur das Portal liegt derzeit auf Eis.
Bleiben wir bei Heraklits Aphorismus. In einem Interview bekennen Sie, dass es Ihnen es ‚unglaublich schwerfällt‘, sich festzulegen.
Prégardien: Selbstverständlich sehnen wir Künstler uns danach, besonders wenn wir jung sind, dass aus etwas über lange Zeit Entwickeltem die richtungsweisende Referenzaufnahme entsteht. Davon bin ich etwas abgekommen, wie man an meiner unterschiedlichen Pianisten-Wahl sieht. Ich singe genauso gerne mit Martin Helmchen wie Lars Vogt oder Kristian Bezuidenhout am historischen Tasteninstrument. Ich habe auch keine eindeutige Präferenz für Hammer- oder für modernes Klavier. Ich bin dankbar für das Zusammenspiel mit so unterschiedlichen Musikern und Menschen. Jeder hat für sich einen anderen Blickwinkel. Bei Eric Le Sage ist es faszinierend, wie er Robert Schumanns Musik liest, weil er dessen gesamte Klaviermusik kennt. Die „Winterreise“ habe ich gewiss mit zehn verschiedenen Pianisten interpretiert. Ein Gerhard Opitz hat eine andere Tempo Vorstellung von einem mäßig wie etwa ein Pianist, der sich mit historischen Zeitmaßen auseinandergesetzt hat. Das gleiche gilt auch für die Oper, etwa eine „Zauberflöte“ mit Barockorchester oder an der Staatsoper Berlin.
Wie ist das mit den Emotionen? Christian Gerhaher sagte mir im Interview, er möge es nicht, wenn bei seiner Winterreise das Publikum mit der Einstellung käme, sich jetzt „eineinhalb Stunden Existenzialismus zu gönnen, um sich am Schauerlichen zu delektieren“.
Prégardien: Nach vielen Aufführungen habe auch ich eine gewisse Distanz dazu. Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich fast schon ins Kommentieren komme und meine Persönlichkeit hineingreift. Als ein noch junger Mann, der auch schon Liebes-Leid und Kränkung erlebt hat, sehe ich, wie ich das lyrische Ich am Kragen packen möchte, in der Art: ‚Mensch, warum bist du denn so dumm und sagst, dass du dir ‚selbst den Weg weisen‘ musst, statt dir Hilfe zu suchen? Keiner verbietet dir das!‘

Nun hat Schubert diese Lieder vor Sigmund Freud geschrieben…
Prégardien: Ja, das stimmt. Aber auch ein Freund kann in einer Krise helfen, nicht nur der Psychologe. Eine wichtige Frage ist aber, ob man das „Schauerliche“ erwartet, oder ob es einem einfach widerfährt. Als Künstler steht man doch vor dem Dilemma, ob man die Erwartungen erfüllt oder sich davon frei macht und sagt: ‚Ich bin beauftragt, diese Musik am Leben zu halten und am Heute zu spiegeln“.
In Denis Diderots Schrift ‚Das Paradox über den Schauspieler’ heißt es: „Wie eine Maschine muss der Schauspieler die natürlichen Anzeichen einer Gemütsbewegung reproduzieren, ohne innere persönliche Beteiligung, will er das Publikum bewegen; der Scharfblick des Schauspielers ist gefordert, nicht seine Empfindsamkeit.“ Und: „Erst wenn der Schauspieler nicht selbst gerührt ist, vermag er zu rühren“.
Prégardien: Ein Lied ist tatsächlich nicht zur Selbsttherapie da. Wenn ich mich den Gefühlen und Affekten hingäbe, beim Singen zum Beispiel weinen würde, könnte ich nicht weitersingen. Ich bin dazu verpflichtet Distanz zu wahren. Was da im Hirn stattfindet, finde ich höchst faszinierend, weil bei aller Hingabe trotzdem noch so ein bisschen Kontrolle übrig bleibt. Auf der anderen Seite: Kunst spielt ja auch mit dem Erfahrungshorizont des Betrachters, und ich bin gleichzeitig Betrachter und Ausübender. Ich bin ja nicht nur Künstler, sondern auch Mensch. Natürlich spielt mit hinein, was ich erlebe. Wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich der Vermittler zwischen den Welten.