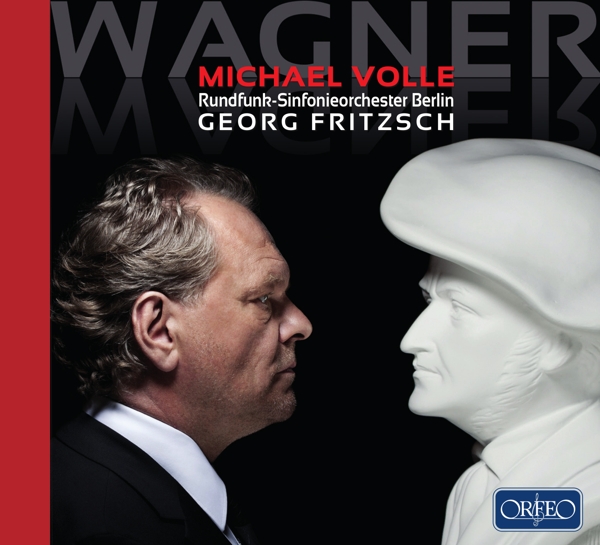Die Vögel zwitschern im Hintergrund während des Telefonats mit Georg Fritzsch. Der designierte Generalmusikdirektor des Badischen Staatstheaters weilt in Schleswig-Holstein, sind doch seine geplanten Konzerttermine coronabedingt abgesagt.
Herr Fritzsch, wie muss man sich den Alltag eines Dirigenten in Coronazeiten vorstellen?
Georg Fritzsch: (lacht…) Meinen Tagesablauf möchten Sie wahrscheinlich nicht wissen, der ist so untypisch für einen Dirigenten. Ich bin hier auf unserem Grundstück. Meine Frau freut sich, dass ich da bin, meine Pferde freuen sich. Ich freue mich, dass ich in der Natur bin. Auf der anderen Seite bedauere ich sehr, dass die vielen schönen Dinge, die ich hätte machen dürfen, nun nicht stattfinden können.
Sie können der Situation also auch Positives abgewinnen?
Fritzsch: Also ich kann nicht sagen, dass diese Zeit vergeudet wäre, im Gegenteil. Es ist eine Fermate in meinem ansonsten sehr bewegten Leben mit vielen Kontakten und Aufgaben. Ein Einhalten, das einen zur Besinnung bringt.
Nun geht es ja fest angestellen Musikern wie Ihnen noch vergleichsweise gut, sie bekommen ihr Gehalt weiterbezahlt. Aber für viele freie Musiker und Künstler geht es derzeit um die nackte Existenz.
Fritzsch: Absolut. Ich habe gut reden, aber die Situation für sehr viele freie Künstler ist teilweise existenzbedrohend. Vor kurzem hat mich ein Kollege angerufen, der schon jahrelang international erfolgreich freiberuflich tätig ist. Wenn das noch bis Februar so weitergehe, müsse er sein Haus verkaufen.
Ob die Saison im Herbst in Karlsruhe wie geplant starten kann, steht ja noch in den Sternen. Gibt es einen Plan B, falls Opern und Konzerte nicht wie vorgesehen stattfinden können?
Fritzsch: Selbstverständlich. Ich sage immer: Es sind A-Bedingungen, wenn es normal läuft, und C-Bedingungen unter Corona. Es wäre töricht davon auszugehen, dass im September alles wieder vorbei ist. Andererseits kann bis dahin auch noch viel passieren.
Sie wechseln von Kiel nach Karlsruhe, also vom hohen Norden in den Süden. Was erwarten Sie sich von diesem Wechsel?
Fritzsch: Ich habe ja bereits im letzten Jahr in Kiel aufgehört, nach sechzehn Jahren. Das war eine reiche und schöne Zeit. Ich war gar nicht auf der Suche nach einer neuen Stelle, es war mehr eine Gelegenheit, die sich geboten hat. Wissen Sie, ich bin ja in Dresden aufgewachsen, einer Stadt, die seit Heinrich Schütz tief verwurzelt ist in der Musikwelt. Für mich unvergesslich war die Zeit mit Herbert Blomstedt, der Anfang der Siebzigerjahre Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle wurde. Später hat Nikolaus Harnoncourt dort eine kleine musikalische Revolution ausgelöst. Dieses produktive Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Innovation finde ich am Badischen Staatsheater nun ebenfalls vor: ein sehr traditionsreiches, agiles, gut klingendes Orchester und insgesamt eine Haltung, die das Theater nicht als Museum begreift. Denn Theater darf nicht per se zu einer Institution mit Wellnessanspruch werden. Und wenn man dann allein schaut, wer auf dieser Stelle schon alles gewesen ist: Hermann Levi, Felix Mottl, Joseph Keilberth. Lauter große Namen.

Ich höre einen gewissen Stolz heraus, sich in die Liste der Vorgänger einzureihen.
Fritzsch: Weiß Gott! Diese Namen spricht man mit dem Hut in der Hand aus.
Sie haben eben ihre musikalische Sozialisation in Dresden sehr positiv geschildert. Hatten Sie nicht das Gefühl, dass Ihre persönliche Freiheit in der DDR eingeschränkt war?
Fritzsch: Ich hatte ein sehr behütetes Leben mit wunderbaren Eltern, mein Vater war Kantor und Kirchenmusikdirektor, ich bin aufgewachsen mit Musik. Aber natürlich war ich nicht in der FDJ, bin nicht zur Jugendweihe gegangen, war nicht bei den Jungen Pionieren, weil mir das durch den Ruf meines Vaters und den Schutz durch die Kirche möglich war.
Die Kirche hat sie geschützt?
Fritzsch: Ja, sie hatte exzellente Verbindungen in den Westen. Meine Eltern gingen auch nicht zur Wahl. Die kamen dann mit der Wahlurne zu uns nach Hause und sagten: Sie waren noch nicht bei der Wahl. Worauf mein Vater antwortete: Es gibt ja auch nichts zu wählen. Das hätte sich kein Lehrer oder Arbeiter leisten können.
Durfte jeder Musik studieren, der entsprechend begabt war?
Fritzsch: Nein. Mein älterer Bruder, der auch Musik studiert hatte, war dazu noch aus Konzessionsgründen in die FDJ eingetreten. Ich habe das nicht gemacht. Weil es nicht zu mir passte und weil sich, das war Anfang der Achtzigerjahre, die Lage in der DDR durch die Ostpolitik des Westens schon aufgeweicht hatte. Ich dachte einfach, ich probiere es mal. Quasi als Back-up hatte ich schon eine Lehrstelle in einem Gestüt, ich hatte mein Leben lang mit Pferden zu tun.
Wann waren Sie das erste Mal im Westen?
Fritzsch: 1988 durfte ich zu einem Familienbesuch ausreisen. 1989 habe ich zum ersten Mal die Alpen gesehen, schon als Kind hatte ich Alpenpostkarten gesammelt. Ich erinnere mich, wie ich 1989, das war vor der Wende, mit meinem Cellokasten in der Hand in Stuttgart vor der Staatsoper stand und überlegte, ob ich zurückfahren sollte. Aber das Wissen darum, Familie zu haben, die ich vielleicht gar nicht oder für lange Zeit nicht mehr sehen würde, hat mich zurückfahren lassen.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Fritzsch: Auf den Tag nach 25 Jahren habe ich dann in Stuttgart die Wiederaufnahme von „Ariadne auf Naxos“ dirigiert. Das war wunderbar! Wissen Sie, für mich gibt es keine größere Errungenschaft als die wiedergewonnene Einheit und Freiheit. Zu wissen, dass das, was ich Ihnen jetzt sage, nicht abgewogen werden muss nach ideologischen Gesichtspunkten.
Was sind Ihre Pläne für die neue Saison in Karlsruhe? Welche Schwerpunkte möchten Sie setzen?
Fritzsch: Ich möchte die Badische Staatskapelle weiter für die Stadt öffnen und dabei auch andere Säle bespielen als das Staatsheater, das Konzerthaus etwa oder den Johannes Brahms-Saal im Kongresszentrum. Leider gibt es in Karlsruhe keinen idealen Konzertsaal, der der Qualität des Orchesters angemessen wäre. Stichworte Tradition und Innovation: Ich würde gern die aufführungspraktischen Aspekte weiterentwickeln, die mein Vorgänger eingeleitet hat. Grundsätzlich fühle ich mich, je älter ich werde, immer stärker in jener Musik zu Hause, die auch mein Zuhause ist. Mozart, Beethoven, Wagner, Bruckner, die deutsche Romantik, das ist in mir, das muss ich mir nicht mehr erarbeiten. Aber ich werde auch das Zeitgenössische weiter pflegen, selbst wenn ich dabei nicht die gleiche Leidenschaft empfinde, die mich mit Strauss oder Brahms verbindet. Daneben werde ich auch Crossoververanstaltungen anbieten, darunter auch ein Konzert mit dem Sänger Max Mutzke. Ein großartiger Künstler mit Haltung, ich habe schon zweimal mit ihm zusammengearbeitet. Für die Wahrnehmung eines Orchesters in der Stadt sind solche Schnittpunkte sehr wichtig.
Zum Schluss: Welche Botschaft würden Sie an das Publikum angesichts der aktuellen Situation richten wollen?
Fritzsch: Wir laufen gerade Gefahr, das Social Distancing zu kultivieren. Das darf aber kein dauerhaftes Lebensgefühl werden. Menschen sollten sich nahe sein, im direkten wie im übertragenen Sinne. Sonst verlieren wir auch die Nähe zur Musik.