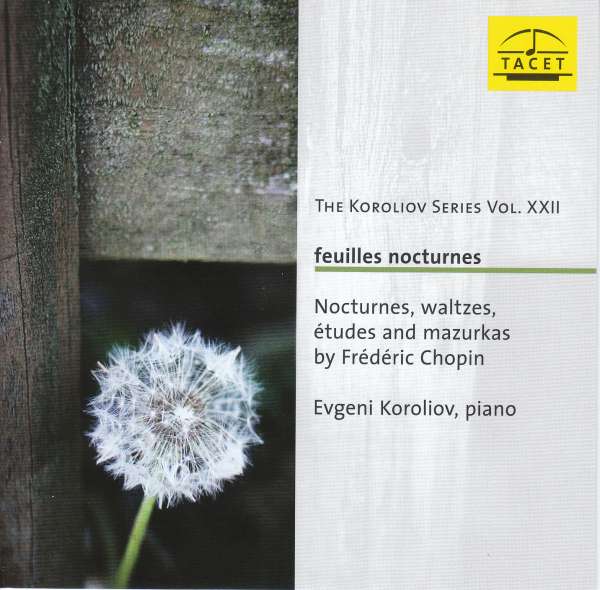Unter Kennern gilt Evgeni Koroliov als einer der interessantesten Pianisten überhaupt, als einer, der die Werke von Bach bis Ligeti bis in die Tiefenschichten durchleuchtet und sie voller Poesie und ohne unnötige Effekte präsentiert. Seit 1978 wohnt und arbeitet Koroliov als Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.
Herr Koroliov, ist es falsch zu sagen, Bach steht im Zentrum Ihres musikalischen Lebens?
Das kann man schon so sagen. Aber ich habe viele Interessen. Eine gilt der ganz alten Musik von der Ars antiqua bis zu Bach. Auch neue Musik interessiert mich, ich habe viel klassische Moderne gespielt, ebenso Ligeti und Kurtág. Aber es ist schwer, in der ganz neuen Musik den Überblick zu behalten, und es wird heute weniger Klaviermusik geschrieben. Das letzte hochinteressante Werk für uns Pianisten waren die Etüden von Ligeti.
Sie waren ja Kollegen an der Hochschule. Verband Sie eine freundschaftliche Beziehung?
Erst ziemlich spät. Er rief mich eines Tages an und fragte mich, ob ich nicht die Kunst der Fuge – er mochte meine Aufnahme sehr – und Stücke von ihm auf einem Festival in Finnland spielen wollte. So sind wir in Kontakt gekommen. Wir hatten viele interessante Gespräche, oft über die ganz alte Musik. Er war eine sehr angenehme Person, sehr witzig, sehr intelligent – und ein großer Musiker.
Zurück zu Bach: Was fasziniert Sie an seinem Werk?
Zunächst einmal ist diese Musik unglaublich gut gemacht. Sie ist oft sehr komplex, aber selbst wenn man sie nicht analysiert, spürt man ihre Größe. Sie hat eine starke Tiefenwirkung, die ganz anders ist als die von Chopin oder Tschaikowsky zum Beispiel. Es ist, als würde man aus der Ferne einen riesigen Berg sehen und könnte doch einschätzen, wie schön es da oben auf dem Gipfel ist. Außerdem sage ich immer, dass ich in Bachs Musik das Gesetz heraushöre, auf dem möglicherweise das Universum aufgebaut ist.
Vielleicht ist es genau das, was Bach beabsichtigt hat.
Ich glaube nicht, dass er sich dessen bewusst war. Er war sozusagen ein Medium, und wir, die wir seine Musik spielen, sind weitere, bescheidenere Medien.
Sie haben ja schon mit 17 Jahren das Wohltemperierte Klavier aufgeführt.
Ich habe Bach sehr früh gemocht, wie auch Mozart und Schubert. Ich habe auf dem Klavier ziemlich schnell Fortschritte gemacht und nach einigen Monaten schon das Präludium in c-Moll, das auch für Laute existiert, gespielt – das hat mich in seinen Bann gezogen. Da war ich vielleicht sieben Jahre alt. Und dann hat mich ein Erlebnis sehr stark geprägt: Meine Lehrerin hat mich immer wieder in Konzerte mitgenommen, und einmal war Glenn Gould zu Gast im Moskauer Konservatorium – er war gerade auf einer Tournee durch die Sowjetunion. Er hat über Bach gesprochen und drei Kontrapunkte aus der Kunst der Fuge gespielt – diese Stücke haben mich damals unglaublich fasziniert.
Sind Ihnen nie Zweifel gekommen, ob es richtig ist, Bach auf dem modernen Flügel zu spielen?
Ich bin kein Ideologe. Am schönsten klingt Bach vielleicht auf dem Clavichord, doch das ist so leise, dass ich es nur für mich spielen kann. Aber ich sehe keinen Grund, Buße zu tun, ich denke, wir Pianisten können sehr viel für diese Musik tun.
Der Cembalist Andreas Staier sagt: Bachs Fugen mit ihrem Stimmengeflecht seien für ein Instrument ohne Dynamik geschrieben, aber auf dem modernen Flügel müsse man mit Dynamik arbeiten.
Da hat er Recht. Aber nicht hundertprozentig. Ich bin nach langjähriger Praxis überzeugt davon, dass es Stücke gibt, die Bach nicht für das Cembalo, sondern für Clavichord geschrieben hat – dessen Dynamik natürlich viel feiner ist als die des modernen Flügels. Es gibt „Claviermusik“ von Bach, bei der man keine Zeit hat, zwischendurch wenigstens ein bisschen zu registrieren. Die klingt auf dem Cembalo etwas fade, aber auf dem Clavichord oder dem Flügel wunderbar. Und noch etwas: Die Cembalisten arbeiten sehr viel mit Agogik. Aber vieles in Bachs Musik ist so gebaut, dass man durch kleinste dynamische Nuancen und durch Phrasierung sich bei der Agogik zurücknehmen kann. Zu viel Agogik klingt auf dem Flügel nicht gut.
Ist es ein Talent, ein Gespür für das richtige Tempo zu haben? Oder kann man das lernen?
Das ist sicherlich eine Mischung aus Intui-tion, Wissen und Erfahrung. Arturo Toscanini hat gesagt, in jedem Stück könne man eine Stelle finden, an der man merkt, nur dieses eine Tempo ist richtig. Vielleicht hat er Recht. Ich glaube, in der Wiener Klassik muss man ein richtiges Tempo finden, während Barockmusik und besonders Bachs Musik in verschiedensten Tempi gespielt werden kann – und trotzdem große Musik bleibt. Mehr noch, ich habe das Gefühl, dass seine Musik die robusteste ist. Selbst wenn man sie nicht besonders gut spielt, bleibt es gute Musik. Mozart dagegen bricht sofort auseinander.
Mischa Maisky sagt, es sei eine Beleidigung, Bach als Barockkomponist zu bezeichnen.
Bach hat so viele Facetten. Rein psychologisch – nicht stilistisch natürlich – würde ich ihn eher zur Renaissance oder sogar zur Ars nova zählen. Aber er hat auch richtige Barockmusik im guten Sinne komponiert.
Ist er Ihnen als Mensch nahe?
Ich will mir nichts anmaßen, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, ich habe dem Meister über die Schulter geguckt – mit der Seele, wenn Sie so wollen – und weiß, was er mit einem Stück meinte.
Ist Ihnen die Person Bach wichtig beim Spielen?
Chopin oder Schumann sind als Persönlichkeiten wichtig für das Spielen ihrer Musik. Bachs Musik ist so allumfassend und gewichtig. Die Person Bach interessiert mich schon und ist mir sehr sympathisch, aber sie hat keinen unmittelbaren Einfluss darauf, wie ich seine Musik spiele. Die ist für mich irgendwie selbsterklärend. Übrigens habe ich einige Male nachts davon geträumt, dass ich Chopin in einem Salon spielen höre, und er spielt ganz anders, als man es sich vorstellt. Ich glaube, wir würden uns sehr wundern, wenn wir Bach, Mozart oder Chopin hören könnten.
Ein Kritiker hat Sie mal eine „Orchidee in der von Effekthascherei geprägten Pianistenwelt“ genannt. Fühlen Sie sich wohl in der Rolle des Geheimtipps?
Ich fühle mich damit sehr wohl. Wenn man mich einen Bach-Spieler nennt, habe ich nichts dagegen, auch wenn es nicht ganz stimmt. Es ist ein schönes Etikett.
Sie wollten nie für die Karriere Tschaikowsky, Rachmaninow oder Liszt spielen?
Nein! Es gibt Leute, die das angenehm und erstrebenswert finden, für mich wäre es langweilig. Das ist schöne Musik, keine Frage, auch angenehm für das breite Publikum. Ich habe mit 14, 15, 16 viele dieser Stücke studiert und zum Teil im Konzert gespielt, aber danach hat mich das Klavierspielen an sich nicht mehr interessiert. Mich interessiert die Musik selbst, und zwar existenziell, ich kann nicht leben, ohne dass ich immer neue Musik spiele oder zumindest höre. Aber ich gehe von der Musik aus und nicht vom Instrument.
Dann hätte der Schritt zum Dirigieren doch nahe gelegen.
Ich war auch nahe dran, man hatte mir schon in der Zentralen Musikschule nahegelegt zu dirigieren. Es ist nicht dazu gekommen, aber das bedauere ich nicht. Als Dirigent ist man fast ständig im Konflikt mit irgendjemandem, und das würde mich ermüden. Dieses Ideal vom musikalischen Leben, das ich irgendwie auch lebe, könnte ich als Dirigent viel schwerer umsetzen. Wenn ich an einen mittelmäßigen Flügel gerate, finde ich durch etwas Arbeit und Erfahrung doch fast immer eine gemeinsame Sprache mit dem Instrument. Ich fürchte, das wäre mit einem mittelmäßigen Orchester viel schwieriger. Das würde mich frustrieren.
Gehen Sie gern auf die Bühne?
Was ich mag, ist die Möglichkeit, auf der Bühne ein großes Werk anzugehen mit voller Energie und sozusagen vollem seelischen Einsatz. Das Publikum vergesse ich dabei, weil meine Aufgaben in dem Moment so überwältigend sind. Ich habe fast mein ganzes Leben nur das gespielt, was mir gefällt, und habe die daraus resultierenden Nachteile gern in Kauf genommen. Sowieso könnte ich nie hundert Konzerte im Jahr spielen. Ich spiele so viel, dass ich es verkraften kann und mit Interesse und Lust aufs Podium gehe.
Sind Sie auch mit Leidenschaft Lehrer?
Am Anfang war es weniger Leidenschaft als vielmehr Not, ich hatte Familie und nicht genug Konzerte, um davon zu leben. Aber es ist interessant, sich mit begabten jungen Leuten über Musik auseinanderzusetzen.
Wie sind Sie überhaupt nach Hamburg gekommen?
Ich hatte eigentlich die beste Stelle: Ich war Assistent im Hauptfachstudium am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau. Aber das Leben in der Sowjetunion war mir zu unfrei, zudem ist meine Frau Mazedonierin, uns sind deshalb einige Unannehmlichkeiten entstanden, zum Beispiel wurden Tourneen abgesagt. Sie ist dann mit unserer Tochter nach Skopje, ins damalige Jugoslawien ausgereist, und ich bin nachgekommen – das war nicht einfach und hat lange gedauert. Und dann war eines Tages ein Freund mit dem NDR Sinfonieorchester in Skopje: David Geringas, damals Solo-Cellist im Orchester. Er sagte, ihr müsst in den Westen, in Hamburg wird gerade eine gute Professur ausgeschrieben. Ich habe also meine Papiere hingeschickt, wurde eingeladen und tatsächlich gewählt – als Sowjetbürger, das hatte ich nicht erwartet. Ich habe meine Frau angerufen, und sie meinte: Sag zu, das ist eine gute Sache. So sind wir nach Hamburg gekommen.
Haben Sie Ihre Frau Ljupka Hadzigeorgieva tatsächlich über die Musik kennengelernt?
Sie war Studentin im gleichen Semester wie ich am Tschaikowsky-Konservatorium. Wir haben Sympathie empfunden, wir konnten beide gut vom Blatt spielen, und so haben wir viel Musik vierhändig gespielt, viele Sinfonien von Haydn und Beethoven. So sind wir uns näher gekommen, und bis heute spielen wir oft als Klavierduo zusammen.