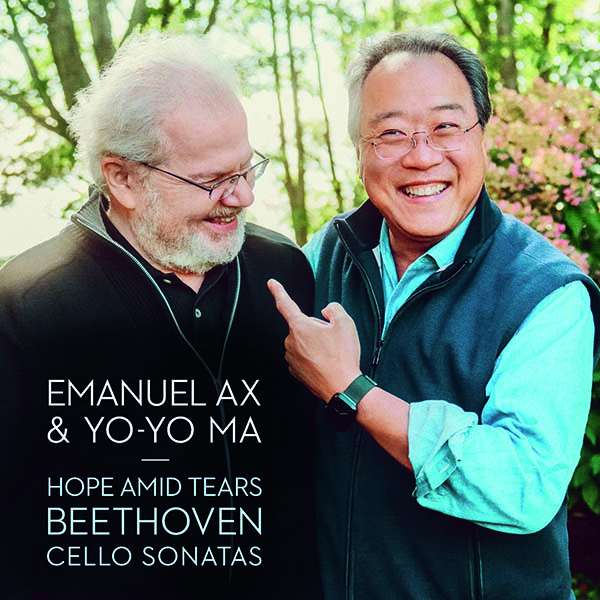Eine umfangreiche Diskographie, ein mit Recitals und Orchesterkonzerten gefüllter Tourneeplan sowie eine Professur an der Juilliard School – Emanuel Ax scheint ein Arbeitstier zu sein. Beim Telefon-Interview, das er kurz vor einem Konzert in Indianapolis gibt, wirkt der 63-jährige Pianist allerdings so entspannt, dass klar wird: hier fühlt sich jemand in seinem Beruf pudelwohl.
Mr. Ax, wenn man sich Fotos oder CD-Cover von Ihnen anschaut, fällt auf, dass Sie häufig einen Schlips tragen…
Ja, das stimmt, in der Regel trage ich einen Schlips. Das ist doch aber ganz normal, oder?
Man sieht es bei Pianisten nicht mehr häufig.
Vielleicht bin ich da etwas altmodisch. Aber keinen Schlips zu tragen, ich denke, dafür bin ich jetzt schon zu alt. Woran ich allerdings nicht mehr glaube, ist der Frack.
Warum?
Die Leute sollen keine Angst davor haben, in ein klassisches Konzert zu gehen. Sie sollen nicht das Gefühl haben, dass wir auf der Bühne 100 Jahre hinterher sind, sondern dass diese Musik jetzt stattfindet, Teil unseres Lebens und der Gegenwart ist und wir uns deshalb auch nicht so kleiden wie vor 100 Jahren.
Ist ein gewisser Dresscode dennoch wichtig?
Ich denke, wir sollten anziehen, was wir wollen. Und für mich sind Schlips und Jackett durchaus bequem. Viele Pianisten fühlen sich heute auch einfach im schwarzen Shirt wohl, was auch völlig in Ordnung ist.
Gibt es noch andere Traditionen im Konzertsaal, die überflüssig sind?
Ja, zum Beispiel, dass der Satz eines Klavierkonzerts zu Ende geht – und niemand traut sich zu klatschen.
Wünscht man sich da als Musiker nicht eine konzentrierte Atmosphäre, die von niemandem gestört wird?
Also, nehmen wir zum Beispiel den ersten Satz von Beethovens fünftem Klavierkonzert – der hat ein so kraftvolles Ende, da ist es für mich offensichtlich, dass dort eine Art Pause sein muss, wo die Leute ihre Freude und Bewunderung für das gerade Gehörte rauslassen können. Als Pianist kannst du dann durchatmen und den zweiten Satz beginnen. Es besteht auch kein Zweifel, dass zur Zeit Beethovens an so einer Stelle applaudiert wurde.
Was ist Ihrer Meinung nach außerdem wichtig, um die Klassik heute attraktiver zu machen?
Ich stelle leider fest, dass es für einen jungen Menschen heute so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit denen er seine Zeit verbringen kann. Als ich jung war, hat fast jeder ein Instrument gelernt – heute gibt es Computer, Kino und tausend andere Dinge, weshalb junge Menschen kein Instrument mehr lernen. Deshalb wird auch das Publikum für klassische Musik kleiner. Insofern wäre das Wichtigste, dass Kinder in dem Moment, wo sie anfangen Mathe, Literatur und Sprachen zu lernen, auch beginnen, ein Instrument zu spielen. Die Liebe zur Musik ist für den Menschen ja etwas ganz Natürliches.
Nun ist das Erlernen eines Instruments auch eine Geldfrage, Sie unterrichten an der Juilliard School, wo ein Studium hohe Kosten mit sich bringt.
Das kann sein. Aber ich denke, Geld ist bei dieser Sache nicht das größte Problem. In den USA kannst du in deiner Gegend auch immer eine Musikschule finden, wo es kostenlosen Unterricht gibt, auf allen Instrumenten. Da ist eine Hochschule wie Juilliard etwas anderes, man muss ja kein professioneller Pianist werden, um sich an Musik erfreuen zu können.
Wer finanziert diese kostenlosen Musikschulen, die Regierung?
Nein, das sind Privatpersonen und Sponsoren, unsere Regierung ist daran leider nicht besonders interessiert. Vielleicht hat sie auch nicht das Geld dafür, das weiß ich nicht genau. Es ist aber generell so, dass wir Musiker kaum Unterstützung vom Staat bekommen.
Beneiden Sie in dieser Hinsicht Länder wie Deutschland oder Frankreich?
Das ist für mich schwer zu beantworten. Denn in den USA gibt es eine lange Tradition privater Finanzierung, da übernehmen Einzelpersonen oder Firmen Kulturförderung. Jeder, der kann, leistet dazu seinen finanziellen Beitrag, ich selbst auch, dafür wird dieses Geld auch nicht von der Regierung besteuert. Es ist ein anderes System als in Deutschland, aber ob es besser oder schlechter ist, kann ich nicht sagen. Natürlich ist es wunderbar in Deutschland, wo die öffentliche Hand die Kultur enorm unterstützt. Aber dann sehe ich in den USA auch viele tolle private Institutionen, die das gleiche tun. Die Carnegie Hall zum Beispiel, einer der wichtigsten Konzertsäle der Welt, wurde von dem Industriellen Andrew Carnegie aufgebaut, das war eine rein private Finanzierung.
Welchen Eindruck haben Sie als Lehrer vom Klaviernachwuchs?
Ich muss sagen, dass ich noch nie so ein fantastisches Niveau beobachtet habe wie heute. Im Moment habe ich zwei Studenten, die sind technisch unglaublich gut, haben aber auch ein großes künstlerisches Temperament. Wenn die zu mir kommen, bin ich sehr beeindruckt, manchmal habe ich sogar das Gefühl, mehr von ihnen zu lernen als andersherum.
Sie selbst haben sich einmal als einen „langsamen Lerner“ bezeichnet.
Oh ja. Da bin ich tatsächlich langsamer als meine Schüler, viel langsamer. Angenommen, ich müsste eine Beethoven-Sonate neu einstudieren, würde im Juni damit beginnen, dann könnte ich sie wahrscheinlich erst im Oktober aufführen. Ich brauche ein paar Monate, um mich mit einem Werk so wohlfühlen zu können, dass ich es auf der Bühne spielen kann.
Sie widmen sich sehr viel großen Komponisten wie Haydn und Beethoven, spielen aber auch zeitgenössisches Repertoire. Glauben Sie, dass es unter den heutigen Komponisten noch Genies gibt?
Ich spiele im Moment zum Beispiel ein Werk von Christopher Rouse, dessen Musik ich sehr mag. Ich liebe außerdem die Musik von John Adams, einige Stücke von Steve Reich, Esa-Pekka Salonen und Kaija Saariaho. Doch wer davon ein großer Komponist ist, das wird die Zeit zeigen. Wir werden erst in 50 Jahren wissen, was von diesen Werken übrig bleibt.
Was waren für Sie als Pianist die wichtigsten Einflüsse?
Als ich jung war, hatte ich das Glück, in New York zu leben, wo ich all die großen Pianisten hören konnte: Rubinstein, Horowitz, auch Richter, Gilels, Rudolf Serkin, den jungen Vladimir Ashkenazy und den jungen Pollini. Die haben mich als Student sehr fasziniert – und wir alle sind beeinflusst von dem, was wir hören.
Inwieweit reflektiert das Spiel eines Pianisten auch die eigene Lebenserfahrung?
Ich denke tatsächlich: Das Klavierspiel ist dein Leben. Alles wird reflektiert: Was dein Lehrer dir gesagt hat, deine Freunde, was du von anderen Pianisten gehört hast, die Dinge, die du sehr gemocht hast, und manchmal auch die Dinge, die du nicht gemocht hast. Wenn du ein Stück Musik spielst, dann wird in gewisser Weise dein ganzes Leben, das hinter dir liegt, in den Gefühlen reflektiert, die du mit dieser Musik zum Ausdruck bringst.
Mit zehn Jahren kamen Sie mit Ihren Eltern aus Polen nach Kanada. Können Sie sich an die ersten Tage dort erinnern?
Ja, das Spannendste damals für mich – einen Jungen, der hinter dem Eisernen Vorhang aufgewachsen war – das war die westliche Technologie. Ich hatte zum Beispiel vorher noch nie Fernsehen geguckt, auch so große Autos kannte ich nicht, ich wusste auch nicht, was ein Toaster ist. Mich fasziniert Technologie deswegen auch heute noch. Ich bin zwar nicht besonders gut darin, sie zu bedienen, aber ich habe trotzdem immer ganz gerne das neueste iPhone oder iPad. Solche Dinge liebe ich.