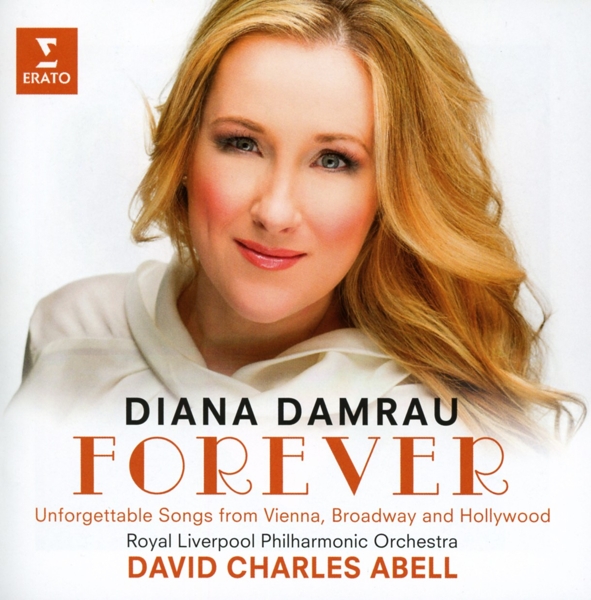Die Luft unter den Weltstars der Oper ist bekanntlich dünn. Doch selbst unter ihnen gibt es nur wenige, die mit ihrem Gesang so einnehmend, so entwaffnend auf die Opernbesucher wirken können wie Diana Damrau. Umso erstaunlicher, dass der Mensch Damrau so bemerkenswert bodenständig ist.
Frau Damrau, Meyerbeers Opern gehören ja nicht gerade zu denjenigen, die man als erstes kennenlernt. Wann war es denn bei Ihnen so weit?
Diana Damrau: Während meines Studiums ist Meyerbeers Musik vom Universitätsorchester Würzburg an mich herangetragen worden, da sollte ich in „Gli Amori de Teolinda“ singen. Schon da war ich schlicht begeistert, allein schon das Duo mit der Klarinette in dieser Kantate! Und dann bin ich eingetaucht in die Musik Meyerbeers, habe mehr und mehr von ihm gesungen. Mein Verhältnis zu diesem Komponisten ist über all die Jahre mit mir gewachsen, als ob es ein Kind von mir wäre.
Liegt das auch am Komponisten und Menschen Meyerbeer selbst?
Damrau: Auch an Meyerbeer selbst! Der Komponist war ein echter Europäer: ein deutscher Jude, der bei Salieri gelernt hat und in Italien seine Karriere startete, der aber auch französische Stücke komponiert hat …
… und der neben dem italienischen und französischen Musikgeist auch den deutschen in sich trug.
Damrau: Auch das hat mich schon immer an ihm beeindruckt: dass man bei ihm meint, eigentlich drei Komponisten zu hören. Und für einen Sopran ist seine Musik einfach ein Schlaraffenland.
Trotzdem haben Sie nie eine Meyerbeer-Oper szenisch aufgeführt.

Damrau: Leider noch nicht! Eigentlich hätte ich „Robert le Diable“ in Covent Garden machen sollen, doch das war mir leider durch die Schwangerschaft mit meinem zweiten Kind nicht möglich. So kam’s dazu, dass es bislang nie geklappt hat mit Meyerbeer auf der Bühne. Aber trotzdem war er bei mir immer präsent. 2001 habe ich in Frankfurt „Les Huguenots“ konzertant aufgeführt – zweimal ausverkauft, eine Riesensache. Da habe ich die Marguerite de Valois gesungen, eine Partie mit tollen Koloraturarien, einfach wunderschön! Aber trotzdem gehört Meyerbeer auf die Opernbühne!
Wo er aber selten anzutreffen ist. Woran liegt’s Ihrer Meinung nach?
Damrau: Weil die Stücke unglaublich schwer zu realisieren sind! Er hat ja mit seiner Grand opéra wirklich in jederlei Hinsicht groß gedacht: der Besetzung, der Solopartien, die sich aus fast jedem Stimmgenre zusammensetzen und für alle Sänger unfassbar schwer zu singen sind. Man braucht also ein entsprechendes Ensemble. Natürlich ist auch immer ein Chor dabei, ein riesiges Orchester, oft auch ein Ballett, und dann sind es noch sehr lange Stücke, kurz: Für ein Opernhaus ist es letztendlich auch eine Frage des Geldes.
Was fasziniert Sie denn so an Meyerbeer?
Damrau: Seine Koloraturstücke vor allem – auf die habe ich mich anfangs regelrecht gestürzt. Die sind fast wie Belcanto, bei dem man als Sänger eine große Verantwortung hat.
Inwiefern?
Damrau: Man muss alle Farben einbringen, außerdem sind gerade seine deutschen Stücke manchmal ein bisschen sperrig. Und man braucht eine Weile, bis man herausgefunden hat, was man aus dem Stück machen kann. Aber es ist immer der Arbeit und Mühe wert. Nehmen Sie zum Beispiel die Arien aus „L’Africaine“: Die sind erst mal schön lyrisch, alles wunderbar, aber dann kommen wieder diese hohen Stratosphären-Töne, die man dann auch noch im Pianissimo singen muss. Doch gerade diese Stellen befördern uns in eine ganz andere Sphäre, haben geradezu transzendentale Wirkung.
Wie verhält es sich bei Ihnen eigentlich mit dem gesungenen Französisch – fällt Ihnen das schwerer als das Italienische?

Damrau: Ach, ich bin doch so frankophil! Die französische Melodie, die französische Musik, das trage ich einfach im Herzen. Ich habe in Französisch Abitur gemacht, habe auch schon während meines Studiums sehr viel Fauré und Debussy gesungen. Die Sprache hat eine gewisse Eleganz, die übrigens auch Meyerbeers Opern haben: Das Saftige, Blutige, Dramatische hat man zwar auch im Italienischen, aber dann kommt beim Französischen noch diese Eleganz und Leichtigkeit dazu, diese Schönheit. Und Meyerbeer konnte wahn- sinnig schöne Melodien schreiben!
Und wie verhält es sich mit der französischen Aussprache?
Damrau: Da habe ich aufgrund meiner Herkunft Glück: Unser bayerisches Schwäbisch hat ja bekanntlich ebenfalls einige Nasale und sitzt relativ weit vorne. Wenn ich aus Niederbayern käme oder aus dem richtigen Schwabenland, dann ginge das etwas weiter ins Gutturale. Da- durch habe ich quasi schon die Anlagen, mich mit dem Französischen leichter anzufreunden.
Was ist denn dann für Nichtschwaben so schwer am Französischen?
Damrau: Man muss lernen, die nasalen Laute richtig zu platzieren, dass die Stimme trotzdem weiterklingt und man dennoch nicht ins Drücken kommt. Und dass es am Ende auch noch so klingt wie gesprochen.
Einfacher hat es da schon Ihr französischer Ehemann, der Bariton Nicolas Testé. Derzeit sind Sie in New York, bald in Los Angeles, wo Sie mit Ihrem Mann auf der Bühne stehen. Macht dieses besondere Sängerduett bald Schule?
Damrau: Wir sind jetzt sieben Jahre verheiratet und haben als Familie und mit unseren Agenten lange daran gearbeitet, dass wir alle möglichst gemeinsam verreisen können. Gewissermaßen sind wir ja fahrende Gesellen, freilich auf einem höheren Level. Trotzdem ist es auch für uns nicht ganz einfach, da die Behörden und die Schulen sowas nicht gerne sehen. Aber wir versuchen zusammen zu bleiben und haben das so organisiert, dass wir in den gleichen Städten auftreten. Es muss ja gar nicht dieselbe Produktion sein. In „Hoffmanns Erzählungen“ in Los Angeles sind wir zusammen auf der Bühne, auch in München sind wir bei den Festspielen gemeinsam in der „Lucia di Lammermoor“ zu sehen. Aber als ich beispielsweise zuletzt in München den „Figaro“ gemacht habe, hat Nicolas währenddessen in „La Bohème“ gesungen. Insofern kleben wir nicht aneinander, wollen aber trotzdem als Familie zusammen sein.
Sorgt für Gänsehaut: Diana Damrau als wahnsinnige Lucia
Schwirrt Ihnen eigentlich manchmal der Kopf, wenn Sie heute an diesem Ort in dieser Inszenierung und morgen an jenem Ort in jener Inszenierung singen?
Damrau: Nein, im Gegenteil: Ich finde das unglaublich spannend! Letzten Herbst zum Beispiel stand ich zeitlich unmittelbar hintereinander als Gräfin Almaviva im „Figaro“ auf der Münchener und der Mailänder Bühne, sang also dieselbe Oper in zwei verschiedenen Inszenierungen mit zwei verschiedenen Ensembles unter zwei verschiedenen Dirigenten. Was soll ich sagen? Ich liebe Mozart-Opern besonders deshalb, weil sie echte Ensemble-Opern sind. Man ist nicht isoliert, man muss spielen, man reagiert auf die Partner. Wenn man das Stück kennt und dessen Schwierigkeiten und Tücken im Griff hat, dann macht es großen Spaß, mit den Kollegen auf der Bühne und im Orchestergraben im wahrsten Sinne des Wortes zu kommunizieren. Da fällt so eine Umstellung erstaunlich leicht.
In Extremform haben Sie das schnelle Umschalten auf Ihrer Meyerbeer-Tournee, wenn sich die Opern-Sujets im Minutentakt ändern …
Damrau: … zumal man für solche Programme vorwiegend die Höhepunkt-Arien wählt. Aber es ist ja auch wieder mein Mann mit dabei – wir teilen uns das Programm. Auf diese Weise kann man dann auch mal ein Duett einbringen, eben eine andere Farbe. Zum Glück ist mein Mann kein Tenor, denn das Bass- bzw. Bariton-Repertoire hört man nicht so oft im Konzert, obwohl es wunderbare Literatur dazu gibt. Aber es stimmt schon: Es werden sehr herausfordernde Abende. Deshalb planen wir auch nichts um die Konzerte herum, denn die Tournee wird wie ein Zehnkampf bei den Olympischen Spielen: Man geht von einem Wettkampf zum nächsten und kann sich nur darauf konzentrieren.
Klingt nach einer anstrengenden Zeit.
Damrau: Die ganze letzte Zeit bei mir war unglaublich anstrengend. Aber ich habe die Kinder erfreulich oft bei mir und kann dann einfach Mama sein. Und wenn ich auf der Bühne stehe und weiß, dass meine Kinder sicher und behütet sind, merke ich, dass ich den schönsten Beruf habe. Ja, es ist derzeit sehr anstrengend. Und dennoch ist es die schönste Zeit meines Lebens.