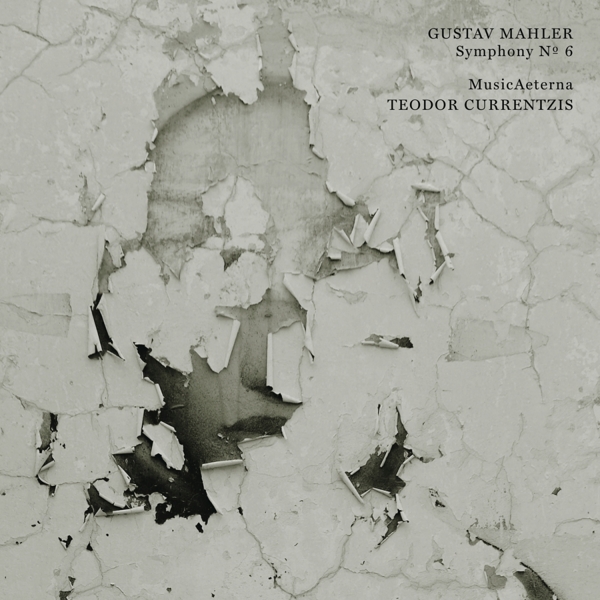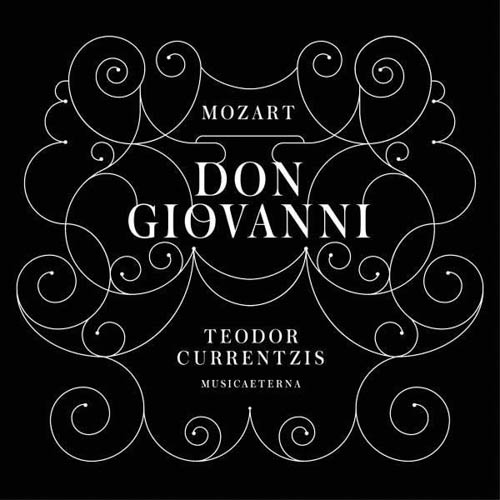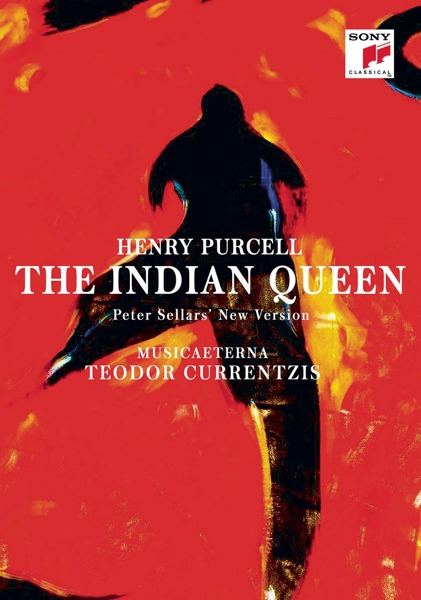Der Begriff „extravagant“ passt durchaus zu Teodor Currentzis. Jedoch ist es zu kurz gedacht, wenn man diese Eigenschaft bei ihm nur auf Äußerlichkeiten reduziert, wie es leider allzu oft der Fall ist. Wer allerdings beispielsweise jüngst bei den Salzburger Festspielen sein MusicAeterna-Ensemble hören durfte, versteht, dass vor allem Currentzis’ Interpretationen das Attribut „extravagant“ im besten Sinne verdienen.
Die Medien nennen Sie einen Dandy, vergleichen Sie mit Oscar Wilde, Dracula oder Nick Cave. Wie sehen Sie sich selbst?
Teodor Currentzis: Ich bin Teodor. Sonst nichts.
… das Geschenk Gottes, wenn man den Namen übersetzt …
Currentzis: Jetzt übertreiben Sie!
Woher kommt diese Vorliebe der Medien, Sie mit allen exzentrischen Persönlichkeiten dieser Welt zu vergleichen?
Currentzis: Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich nur eines: aufrichtig sein mit meiner Kunst.
Nun: Der eine pompöse Auftritt in Klamotten, als gingen Sie zu einem Gothic Festival, schien Ihnen Spaß zu machen.

Currentzis: Das 19. und 20. Jahrhundert kennt Dresscodes für Dirigenten, etwa den Frack. Mit dem Verhalten eines Dirigenten hatte dies allerdings nichts zu tun. Auch ich liebe den Frack, doch manchmal ist mir nach etwas anderem. Eigentlich empfinde ich solche Äußerlichkeiten als sehr oberflächlich. Wenn ich ehrlich bin: Es ist mir eigentlich auch egal, wie man mich nennt oder mit wem man mich vergleicht. Ich achte wirklich nicht darauf. Ich bin Teodor …
… der Schuberts Winterreise liebt und den Gambenklang.
Currentzis: Ich kann wesentlich asketischer sein, als viele glauben. In gewisser Hinsicht geradezu radikal. Ich suche den Geist der Musik, ihre Spiritualität. Ich versuche, die Wahrheit zu finden, um sie von der Lüge abzugrenzen.
Bei den Salzburger Festspielen haben Sie neben Mozarts „Clemenza di Tito” auch sein „Requiem” dirigiert. Sind Sie ein religiöser Mensch?
Currentzis: Ja. Ich habe vor allen Dingen einen Glauben. Damit meine ich allerdings nicht eine Religion. Wir leben ja auf diesem Gebiet in sehr schwierigen Zeiten. Religion hat für mich etwas mit Fanatismus, mit Abgrenzung zu tun. Der Glaube aber verbindet die Menschen, verbindet uns mit der Ewigkeit. Glaube, Zuversicht und Hoffnung. Die geistliche Musik eröffnet uns eine ganz andere Dimension als etwa die weltliche Musik. Doch die göttliche Dimension kann man manchmal auch in ganz einfachen Dingen finden. Und nicht nur in Mozarts „Requiem”.
Der Esoterik-Markt boomt. Hochkomplexe religiöse oder philosophische Traditionen werden weichgespült und trivialisiert, um aus ihnen schnelle Methoden zur „Harmoniegewinnung“ zu machen. Was halten Sie davon?
Currentzis: Gar nichts. Spiritualität hat absolut nichts mit Wellness zu tun. Spiritualität hat etwas mit Transzendenz zu tun. Und das setzt die Anstrengung voraus, sich ernsthaft auf etwas einzulassen. Der Mensch muss sich wirklich mit etwas auseinandersetzen, vor allem mit sich selbst. Das ist wirklich nicht einfach. Ich gehe gerne ins Kloster. Gerade habe ich Hildegard von Bingens Vesper „O vis aeternitatis” eingespielt. In einem Kloster haben wir das aufgenommen.
Ist dies Ihr Weg zu wahrer Spiritualität?
Currentzis: Ja. Einer. Meine große Liebe gilt der byzantinischen Musik. Jeden Morgen höre ich mir in meinem Haus Musik aus dieser Zeit an. Mich interessiert die alte Philosophie der Griechen, der Mythos um Apollon und Dionysos, die ja, wenn man Nietzsche folgt, die Gegensätze darstellen zwischen der Ordnung und dem Rauschhaften, der Form und dem Schöpferischen. Manche Musik würde ich gar nicht gerne aufführen, sondern eher eine spirituelle Session daraus machen, also nicht im Sinne eines öffentlichen Konzerts, sondern eines die Welt verändernden Klangs. Die Musik ist das Echo des Paradieses. Und ich suche den Zugang zu diesem Paradies. So sehe ich Musik.
Wie kamen Sie zur Musik? Sie wuchsen in Athen auf …
Currentzis: Ja. Mein Vater war zunächst Matrose, später wurde er Polizist. Meine Mutter war eine Musikerin. Erstaunlicherweise war es mein Vater, der mir die Liebe zur Musik übertrug. Er war geradezu süchtig nach Musik, hatte unglaublich viele Schallplatten, und wir saßen da und hörten sie an. Es war eine sehr innige Beziehung. Meine Mutter hat mir eher die rationale Ebene vermittelt. Sie hat mir gezeigt, was es alles gab. Ich verglich zwei CDs von Pergolesis „Stabat Mater”. Die Sänger des berühmten Labels waren ungenau, uninspiriert. Die unbekannten Musiker aber waren wahrhaftig. Da wusste ich, in welche Richtung ich gehen wollte, auch wenn ich damals nicht, wie andere, davon träumte, Dirigent zu werden. Ich habe ja noch Geige gespielt und habe komponiert. Doch immer, wenn ich in den Partituren mehr las als vielleicht andere, dachte ich mir, ich könnte es auch als Dirigent versuchen. Und ich hatte recht schnell Erfolg.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt?
Currentzis: Das tue ich! Wir waren damals privat im kleinen Ensemble. Wir machten Kammermusik und lauter interessante Dinge. Irgendwann sagte jemand zu mir: Versuch uns doch mal zu dirigieren. Und wir hatten großen Erfolg. Ich aber dachte mir damals: Ich muss Unterricht nehmen, ansonsten klappt das nicht. Viele Dirigenten glauben, dass das Dirigieren ein Kinderspiel sei. Ich aber bin nicht so naiv oder dämlich. Oder eitel. Als ich dann anfing, Unterricht zu nehmen, war dies der Anfang vom Ende.

Gab es überhaupt eine Alternative zum Musikerdasein? Sie sagten einmal, dass Sie auch Filmregisseur hätten werden können. Als Schauspieler haben Sie sich ja versucht …
Currentzis: Ja, als Lew Landau in „Dau”, einem Film des Regisseurs Ilja Chraschanowski über den einstigen jüdisch-russischen Nobelpreisträger der Physik. Landau war anarchisch, er war ein Hippie im Geiste, hat versucht, eine radikale Welt zu ergründen, er war natürlich ein Atheist und doch glaubte er an einen Gott. Das war ja alles während der Stalin-Zeit! In dem Film ging es um ein totalitäres System und wie es den Geist zerstören kann. Es war sehr spannend, sehr experimentell.
Spannend ist auch, was Sie in Perm, am Rande Europas aufgebaut haben.
Currentzis: Perm ist eine Provinzstadt im Ural, die während der Sowjetzeit Molotow hieß und in der sich das Kriegsgefangenenlager und ein großes Gulag befand. Doch Perm ist auch eine Stadt, in der ich – nein: wir – viele unserer Träume erfüllt haben. Wir, das MusicAeterna-Ensemble, wollen etwas ganz Besonderes erschaffen. Dafür proben wir oft sehr lange. Bei uns sind die Musiker keine Fabrikarbeiter. Musik ist für uns eine Mission und kein simpler Beruf.
„Geben Sie mir fünf oder zehn Jahre“, sagten Sie 2005 im englischen „Telegraph“. „Dann werde ich die klassische Musik retten!“ Und?
Currentzis: Das wurde oft missverstanden. Ich habe das so auch nicht gesagt, jedenfalls nicht so gemeint. Es war ein Gespräch in einer Bar mit einem englischen Journalisten und da hatten wir ein paar Drinks. Es geht mir auch gar nicht darum, die Klassik zu retten. Es muss allerdings einen Grund geben, weshalb die Menschen gerne in meine Konzerte kommen und sich die CDs kaufen.

Heute treten Sie mit MusicAeterna auf allen Bühnen der Welt auf. Doch Sie waren auch an ungewöhnlichen Orten wie etwa in einem Hospiz.
Currentzis: Das war eines meiner größten Erlebnisse! Wie unterschiedlich, wie tief ein Mensch Musik erfahren kann. Nicht nur als eine Ansammlung von Klängen bei einem Glas Champagner, sondern als spirituelle Erfahrung. Im Hospiz, dieser letzten Station des Lebens, haben wir Mozarts „Figaro” gespielt. Von Krankenschwestern umgeben, auch Kinder waren dort. Wir hatten ja nur zwanzig Minuten für die Darbietung. Mehr konnte man so kranken Menschen nicht zumuten. Manche aus dem Ensemble haben Gedichte vorgetragen. Die Schwestern erzählten mir später, dass sich nach dem Konzert erstaunliche Dinge getan hätten. Ein Mann etwa, der zwei Wochen nichts zu sich genommen hatte, fing jetzt wieder an zu essen. Ein anderer wollte plötzlich aufstehen, ein sterbendes Kind sagte, es wolle das Dirigieren erlernen.
Und auch in einem Frauengefängnis in Perm sind Sie aufgetreten.
Currentzis: Die Frauen im Gefängnis hatten Tränen in den Augen, als wir Bach spielten. Es ist wirklich erstaunlich, welche Wirkung Musik haben kann. Auf der einen Seite bist du als Insasse total isoliert und plötzlich wird diese Einsamkeit durchbrochen durch das gemeinsame Erlebnis Musik. Sie hatten nie Bach gehört und verstanden Bachs Motetten vielleicht nicht wie unsereiner. Doch plötzlich wurden sie gewahr, dass es noch eine andere Dimension gibt. Das hat mich alles sehr bewegt. Bei einer anderen Gelegenheit gingen wir zu den Junkies auf der Straße und spielten dort. Und einer sagte: Ich weiß nicht, was das da ist, ich weiß nur, dass es sehr schön ist.
Teodor Currentzis in einer Nahaufnahme: