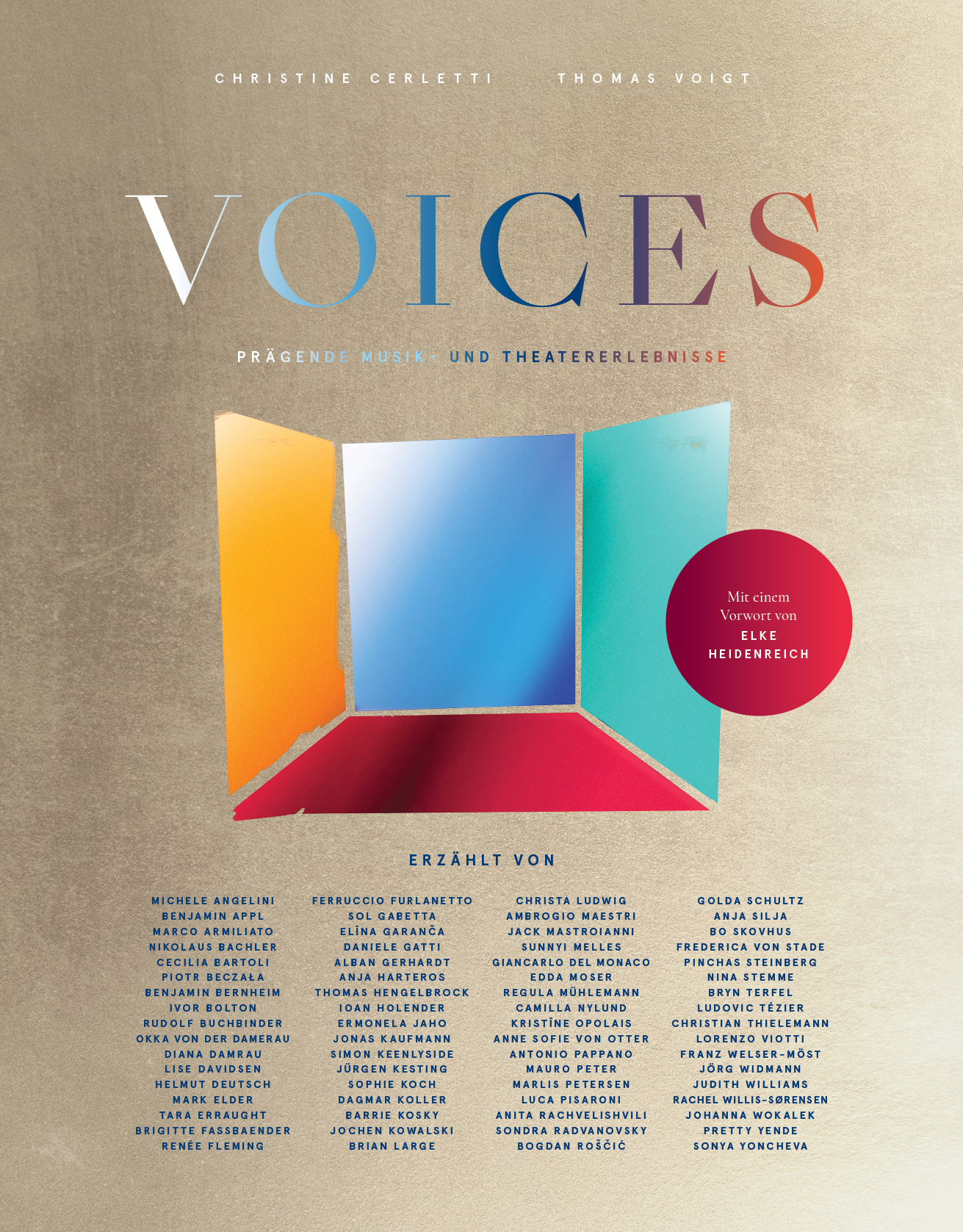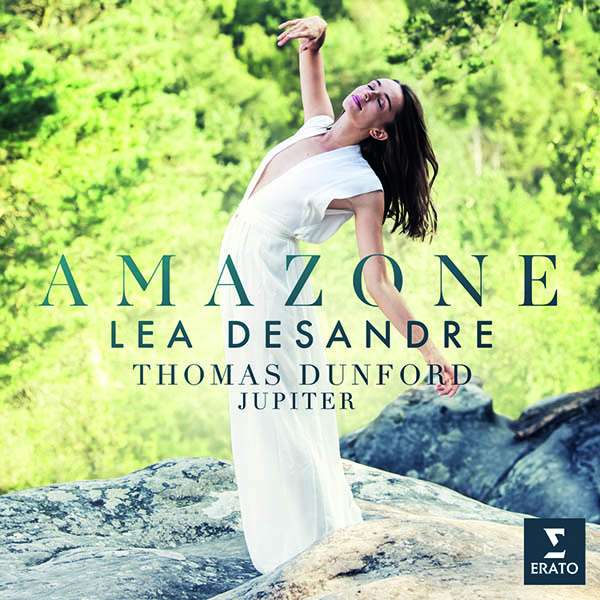„Wir leben in einer lauten Welt“, hat Cecilia Bartoli einmal festgestellt, „also bleibt auch den Sängern nichts anderes übrig als zu brüllen.“ Die gebürtige Römerin selbst musste in ihrer dreißigjährigen Bühnenkarriere nie brüllen, um gehört zu werden: Ihre grandiose Technik und sängerische Disziplin, ihre Repertoire-Neugier und fast familiäre Ausstrahlung hat sie zu einem der beliebtesten Opernstars gemacht.
Ich kenne Menschen, die Ihnen bis in ferne Länder nachreisen, um Sie zu hören. Haben Sie eine besondere Art, Ihr Publikum zu berühren?
Cecilia Bartoli: Oh, da müssen Sie vielleicht die Leute selbst fragen. Ich habe mich als Sängerin eigentlich immer bemüht, dem Komponisten zu dienen – und versuche dabei, mich in die Charaktere hineinzuversetzen: Ich leide mit ihnen, identifiziere mich mit ihnen zu hundert Prozent. „Norma“ zum Beispiel handelt von der intensivsten Liebe, die man sich vorstellen kann. Das ist für mich physisch und psychisch ungeheuer anstrengend, aber es ist doch die große tragische Handlung, die einen angreift.
Also eine Partie, die Sie vor zwanzig Jahren noch nicht verkörpert hätten …
Bartoli: Nicht im Traum! Die Stimme ist erst jetzt reif genug für „Norma“, aber auch meine Seele, mein Denken – man braucht die Lebenserfahrung, um so eine Rolle zu singen. Und erst nach dreißig Jahren auf der Bühne kann ich die Leidenschaft einer Norma wirklich verstehen, auch ihre radikale Todesbereitschaft.

In welche Richtung wird sich Ihre Stimme noch entwickeln – wird Wagner bald dabei sein?
Bartoli: Olala, ich hoffe nicht! Aber ich habe die Iphigenie aus Glucks „Iphigénie en Tauride“ gesungen, das war schon eine Herausforderung. Die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre für mich ist, dass ich Belcanto-Opern heute lieber mit historischen Instrumenten singe. Das war bei der Salzburger „L’Itali ana in Algeri“ so, aber auch bei „Norma“. Wir haben uns viel enger an Bellinis Ideen gehalten als üblich: keine Striche, keine Transpositionen in den Arien. Bellini hat die Rolle der Norma für Giuditta Pasta geschrieben, die damals in Mezzolage gesungen hat. Dann wollten die lyrisch-dramatischen Soprane die Partie singen und haben sie transponiert. Wir sind zur ursprünglichen Partitur ohne die nachträglichen Änderungen zurückgekehrt. Für mich war es eine echte Offenbarung, diese Musik mit den Instrumenten der Zeit zu hören.
Ihre neue Vivaldi-CD hat einen berühmten Vorläufer, nämlich Ihre erste Beschäftigung mit Vivaldis Opernmusik von 1999. Sechs Millionen CDs wurden davon verkauft, und man hat sich gewundert, dass ein Star wie Sie sich nicht mit dem „Barbier von Sevilla“ begnügt, sondern völlig unbekannte Musik ausgräbt.
Bartoli: Als meine erste Vivaldi-CD erschienen ist, wurden alle Arien darauf zum ersten Mal aufgenommen. Für mich ware seine überraschende Erkenntnis, dass Vivaldi nicht nur die „Vier Jahreszeiten“ oder Konzerte für Mandoline und Flöte geschrieben hat. Besonders hat mich fasziniert, wie virtuos Vivaldi die Stimme geführt hat, manchmal unisono mit den Geigen in einem wahnwitzigen Tempo, das kam mir unglaublich verwegen vor. Und es war der Anstoß, meine eigene Technik noch einmal zu überprüfen und zu verbessern. Danach begann das Label Naïve mit seiner Gesamtaufnahme der Vivaldi-Opern, später hat Philippe Jaroussky sein Album herausgebracht … Es gab eine echte Renaissance für Vivaldi, und ich glaube, ich habe das ein bisschen angestoßen. Aber diesmal will ich einen anderen Aspekt seiner Musik zeigen, die auch sehr tiefgründig sein kann, melancholisch, tragisch. Und nachdem ich 1999 die Stimme als extrem virtuoses Instrument vorgestellt habe, kommt jetzt in der neuen CD die emotionale Intensität dazu. Außerdem habe ich mich zwanzig Jahre lang mit Barockmusik auseinandergesetzt und dabei mit großen Dirigenten zusammengearbeitet, mit denen ich neue stilistische und stimmliche Erkenntnisse gewonnen habe. Und diesen Erfahrungsschatz will ich auf der neuen CD zeigen.
Soeben kam außerdem die erste CD der neuen Reihe „Mentored by Bartoli“ heraus, die von Ihrer Stiftung, der „Cecilia Bartoli Music Foundation“ finanziert wird.
Bartoli: Die Grundidee der Stiftung ist, Künstlern wie Javier Camarena, einem der größten Belcanto- Tenöre unserer Zeit, die Chance zu geben, sein erstes Studio-Album zu produzieren. Ich meine keine mitgeschnittene Live-Performance, sondern eine Studioaufnahme, für die man Zeit und Sorgfalt mitbringen muss. Und beides wird für jüngere Künstler immer seltener und teurer: Probenzeit, aber auch die Ruhe, sich diesen Projekten zu widmen. Schön, wenn dabei auch noch ein interessantes Konzept eine Rolle spielt wie bei Javier Camarena, der auf der CD „Contrabandista“ Manuel Vicente García huldigt. García war der Rossini-Tenor am Beginn des 19. Jahrhunderts, außerdem Vater einer Diva assoluta, Maria Malibran. Javier Camarena singt einige Rossini-Arien, aber auch Arien, die García selbst komponiert hat.

Sie sagen oft, dass der Vertrag, den Sie bei Decca unterschrieben haben, für Ihre Karriere wichtig war. Warum?
Bartoli: Man kann einem jungen Sänger nur wünschen, dass er oder sie an einen exzellenten Ratgeber für die Karriere und das Repertoire gerät. Als ich vor dreißig Jahren meinen Exklusivvertrag mit Decca abgeschlossen habe, gab es Producer, die nicht nur für die technischen Aufnahmen zuständig waren, sondern herumgereist sind, nach jungen Künstlern gesucht haben, sich vorsingen ließen. Mein Producer damals war Christopher Raeburn, ein englischer Gentleman, der für mich eine Art Guide durch das Repertoire war – und das war enorm wichtig für mich. Sicher, für Sänger ist der Live-Auftritt auf der Bühne das Zentrum der Karriere und Existenz, ob in der Oper oder im Konzert – da gibt es für mich keine Diskussion. Aber auch im Aufnahmestudio kann man seine Musikalität und Technik verbessern, weil man sich selbst hört und beurteilen lernt.
Sie stehen seit dreißig Jahren auf der Bühne …
Bartoli: Ich werde langsam selbst zum historischen Instrument! (lacht)
Im Gegenteil, Sie erweitern Ihre Aktivitäten noch, singen weiterhin auf der Bühne, sind Festivalleiterin in Salzburg, haben Ihre eigene Stiftung. Neigt man denn mit den Jahren nicht eher zur Konzentration?
Bartoli: Das tue ich auch – zum Beispiel reise ich viel weniger als früher, widme mich den Salzburger Pfingstfestspielen, was auch ziemlich ambitioniert ist. Aber da bewege ich mich in einer anderen Dimension, und davon profitiere ich auch künstlerisch. Ich erfinde jedes Jahr ein anderes Thema, das sich an die neue Opernproduktion knüpft – in diesem Jahr war das etwa Rossinis „L’Italiana in Algeri“, im nächsten Jahr Händels „Alcina“. Das Thema sind dann die „Voci celesti“ mit Musik der Kastraten im 18. Jahrhundert, von Händel, aber auch von seinem großen Konkurrenten Nicola Porpora. Da gibt es viel zu organisieren.
Bleibt da noch freie Zeit?
Bartoli: Oh ja, immer. Nach den Festivals im Sommer nehme ich mir Zeit zum Ausspannen, zum Lernen, für meinen Mann und meine Familie. In diesem Sommer war ich auf Sardinien mit seinem wunderschönen klaren Wasser. Das ist etwas, was man im Laufe der Jahre lernen muss: die Phasen der Ruhe zu genießen, um die Batterie wieder aufzuladen. Vielleicht ist das ein Geheimnis meiner Karriere.
Hören Sie hier Cecilia Bartoli mit „Vedrò con mio diletto» aus Vivaldis „Il Giustino“: