Es war Premiere und Wiederaufnahme zugleich, als wir uns (fast genau 15 Jahre nach unserer ersten Begegnung) in Hamburg zum Gespräch wiedersahen. Der in Schweinfurt geborene Pianist Michael Wollny ist nämlich der erste Jazz-Musiker, der sich unserem Blindtest stellt, und zugleich der erste Künstler, den wir nach der Dürrephase der Kontaktsperren trafen für ein Format, bei dem ein persönliches Treffen unverzichtbar ist.
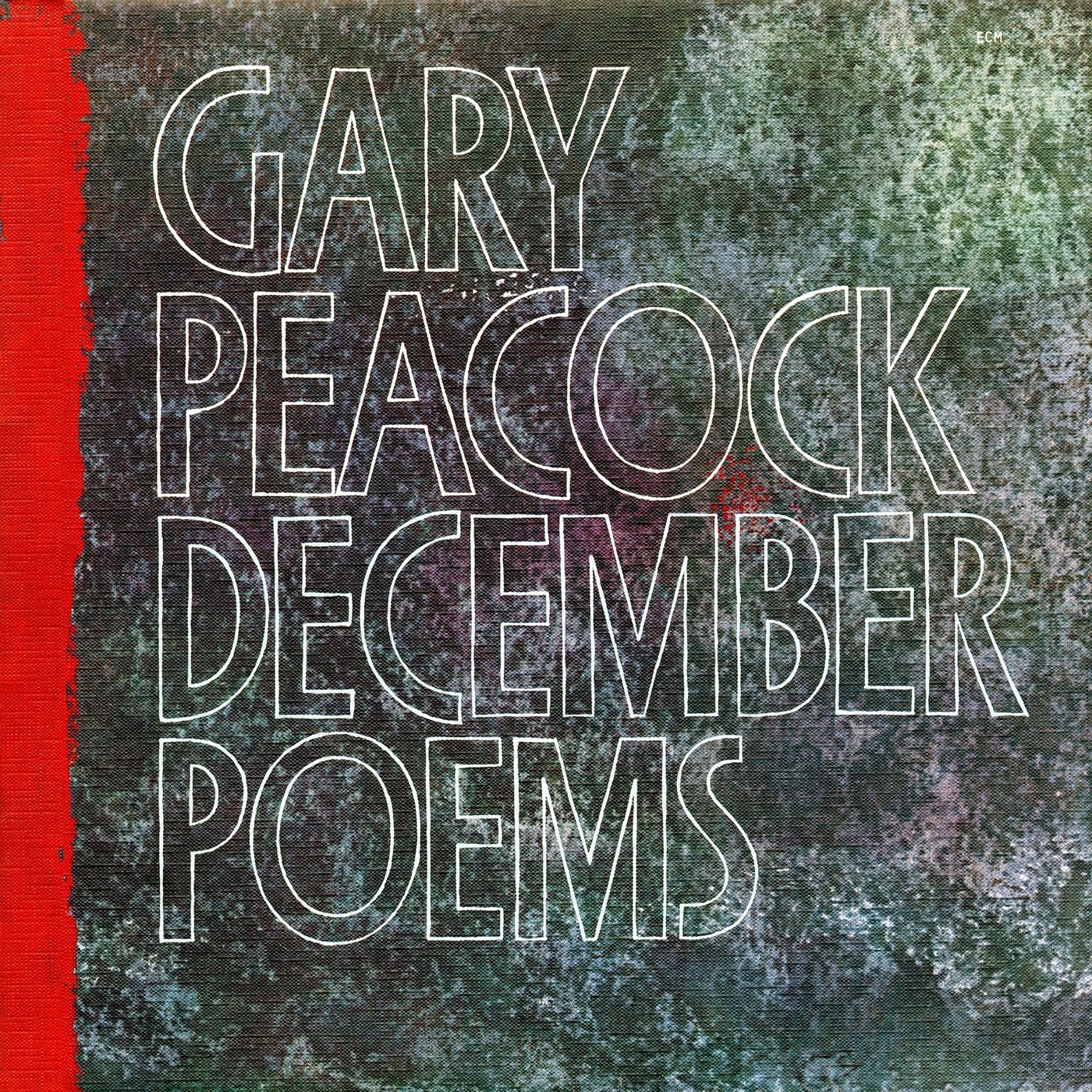
Snow Dance
Gary Peacock
ECM 1979
(Nach dem ersten Ton) Ist das Gary? Sein Sound ist unverkennbar. Ich bin da persönlich ein kleines bisschen angefasst (Gary Peacock verstarb am Vortag des Interviews im Alter von 85 Jahren, d. Red.). Ich hatte das Glück, mit ihm vor fünf Jahren ein Konzert zu geben. Es ist natürlich enorm aufregend, wenn so ein Idol einem plötzlich gegenübersteht. Davon mitgenommen habe ich, was für ein unglaublich herzlicher, warmer, offener und interessierterMensch er war. Beim Soundcheck gab es erst Schwierigkeiten. Die Anlage war nicht gut eingestellt, außerdem waren die Batterien in seinem Hörgerät leer. Und es war nicht einfach, sich über die Stücke und die Leadsheets zu verständigen. Aber ich habe selten ein Konzert mit so großer Klarheit erlebt wie dieses. Vom ersten Ton bis zum Ende war alles wie gemeißelt. Es war unglaublich, wie viele Emotionen und Energien da flossen. Es war ein sehr inniger Moment mit ihm und ein tolles Konzert.

Hevin Hanging – Pleasure Point Music
Joachim Kühn (piano), Daniel Humair (drums), Jean-François Jenny-Clark (bass)
Label Bleu 2013
(Wieder nach wenigen Tönen) Joachim Kühn, Daniel Humair und Jean-François Jenny-Clark! Joachim, ein Held, mein Held, am Klavier. Mein Lehrer Chris Beier hat mir in Würzburg an der Hochschule Aufnahmen von ihm vorgespielt. Das hat mich sofort angesprochen. Ein paar Monate später war ich in München bei einem Doppelkonzert. Da war Michel Camilo solo programmiert, also so ein Latin-Mainstream-Virtuose, und danach Joachim solo. Etwas gewagt. Und tatsächlich: Im zweiten Set haben ungefähr 300 Leute in den ersten zehn Minuten den Saal verlassen. Das war meine erste Begegnung mit Joachim im Publikum. Dann habe ich meine Diplomarbeit über ihn geschrieben, daher kenne ich diesen Stil auswendig. Es ist selten, dass Musiker nicht nur einen eigenen Anschlag, eine eigene Phrasierung, einen eigenen Mood entwickeln, sondern auch eine eigene harmonische Sprache aus diesen zwölf Tönen neu formulieren. Dass jemand im Jazz nur mit Diminished-Augmented-Akkorden eine ganze Welt baut, sowas gab es davor nicht. Das ist so, als würde man einen Gral finden. Natürlich gibt es keinen Jazzmusiker, der ganz unabhängig von anderen Einflüssen irgendetwas tut. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, diesen fundierten eigenen Ausdruck in dieser Welt zu finden, und das geht nur über eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seinem Instrument, der Technik, mit der Geschichte – Dinge, die gar nicht so sehr akademisch oder im Kopf, sondern auch rein körperlich, sinnlich sind. Das ist für mich eine Kernsache: Diese Suche nach dem persönlichen Ausdruck, die offen dafür ist, mit anderen musikalisch zu kommunizieren. Am Ende ist Jazz eine sehr persönliche Angelegenheit. Aber egal, welchen Beitrag man leistet, man ist irgendwie Teil von dieser langen Erzählung.
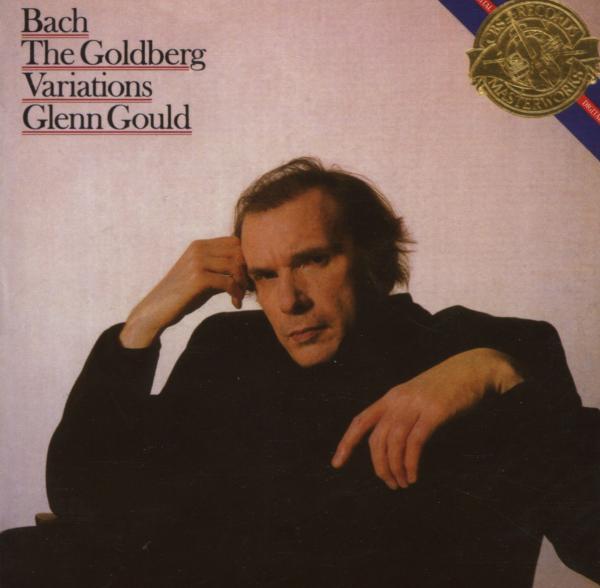
J. S. Bach: Goldberg-Variationen
Glenn Gould
Sony Classical 1981
Ist das seine frühere Aufnahme? Oder die aus den Achtzigern? Das Faszinierende bei dieser Interpretation ist, dass er sich über die ganzen Variationen hindurch auf einen Zeitpuls bezieht, also die Grund-Tempi der Stücke in Relation zueinander anlegt, ein total naheliegender und trotzdem irrer Gedanke. Wenn man alle Variationen am Stück hört, dann stellt sich auch wirklich so ein Fluss ein.

J. S. Bach: Präludium Nr. 1 aus dem Wohltemperierten Klavier, Band 1
Jacques Loussier Trio
Telarc Jazz 2006
Also was es ist, ist klar. Mein erster Klavierlehrer hat damals, als ich Bachs „Französische Suiten“ spielte, davon gesprochen, dass man Bach swingend denken und spielen sollte. (Beim Einsatz des Kontrabasses) Da kommt einem erst mal Jacques Loussier in den Kopf. Für mich war das, mit zwölf, dreizehn Jahren, auch eine Art Initiation. Aber es stellt sich auch die Frage: Soll man das, darf man das? Ist das nötig, braucht es jetzt Ornamentik um die Stücke von Bach herum oder macht das die Sache nicht irgendwie doppelt und dreifach – und irgendwie schwach?

Chopin: Prélude e-Moll op. 28/4
Eugen Cicerto Trio
MPS/Edel 1966
Ist das auch Loussier? Nein? Es ist auf jeden Fall Chopins Prélude e-Moll. Die Aufnahme klingt älter, aber ich weiß, dass auch Trifonov dieses schnelle Tempo gewählt hat für dieses Stück. (Lacht auf, als Bass und Schlagzeug einsetzen) Wenn es nicht wieder Loussier ist, dann Eugen Cicero. Ein großartiger Pianist! Man hört, dass sich die harmonische Sprache von Chopin im Jazz sehr gut spielt. Trotzdem geht es für mich ästhetisch in eine fragwürdige Richtung. Natürlich kann man diese Art von Harmonik und Melodie weiterspinnen, aber man entfernt sich dann eigentlich von der Kunst, die bei Chopins Komposition so kurz und prägnant auf den Punkt gebracht ist. Es ist eine heikle Frage: Was will ich mit diesem Stück? Joachim Kühn hat ja auch Bach gespielt. Da jagt er durch eine Partita für Solo-Violone und ist dann plötzlich in einem Improvisationsfeld, wo einfach die Funken sprühen. Es passieren tausend Sachen, aber es ist nicht nur eine Variation der Variation der Variation von Bach, sondern es ist irgendwie eine neue Tür in seine eigene Welt, die das Ganze nochmal neu befeuert.

Beethoven: Diabelli-Variationen
Igor Levit
Sony Classical 2015
Jetzt muss ich ein bisschen raten. Ist gerade zufällig Jubeljahr des Komponisten? Ich habe mich letztes Jahr mit den „Eroica-Variationen“ beschäftigt. Da ist ja das Interessante, dass diese ganze Kunstfertigkeit, dieser große Fantasiereichtum auf einer ganz banalen Grundlage beruhen. Es gab dieses Jahr, noch vor Corona, einige Anfragen, auch zu Beethoven was zu machen. Ich habe tatsächlich nur diesem Eroica-Projekt zugesagt, dies aber auch nur unter dem Vorbehalt, dass es ein „Gesprächsperformancekonzert“ wird, weil ich das Gefühl hatte, dass ich zu dieser Welt keinen Zugang finde. Die Kunst darin besteht ja gerade in dieser genau gebauten, komponierten Sache. In der Welt des Films etwa gibt es so jemanden wie Kubrick, der jedes Detail kontrolliert und genau baut. Und dann gibt es jemanden wie David Lynch, wo man sagt, da ist vieles mehr oder weniger intuitiv, es gibt kein Gerüst dahinter, das ist alles Traumlogik und es hat sehr viel zu tun mit unsagbaren Sachen. Und am Ende haben die Filme beider Regisseure eine ähnliche Wirkung, dieses Hypnotische, was einen reinzieht, beschäftigt, irgendwo ganz tief berührt.

Peace Piece
Bill Evans
Riverside Records 1958
Bill Evans’ „Peace Piece“? Es ist so interessant, das zu hören nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Die Aufmerksamkeit liegt wieder ganz woanders. Zum Beispiel auf so was wie Time. Das ist ganz klar keine komplette Freiheit, Time ist hier ein Metrum. Es swingt zwar, aber die Phrasierung ist total loose, die schwebt über den ganzen leisen Tönen. Es ist fast unmöglich zu notieren, was da passiert, obwohl es andererseits ganz einfach ist. Der Bauplan ist wie bei Ravels Klavierkonzert G-Dur im zweiten Satz. Die linke Hand spielt ein Ostinato, die rechte Hand singt darüber eine unendliche Melodie. Hier aber ist die Phrasierung viel rauer, expressiver. Und man merkt, dass diese Melodie gerade im Moment entsteht, also nicht im Voraus zu Ende gedacht ist. Je nachdem, was passiert, könnte es jetzt gleich zu Ende sein, es könnte aber auch noch weitergehen. Bei Ravel ist es ein ewig langer Bogen, der sich entspinnt, aber trotzdem merkt man am Anfang schon, wie lange der geht und wo der hingeht. Und hier ist es eher wirklich eine momentane Dichtung. Bill Evans hat ja die Linernotes geschrieben für Miles Davis’ „Kind of Blue“ und spricht da von der japanischen Kunst, Gebilde entstehen zu lassen aus nur einem Pinselstrich. In diesem einen Pinselstrich liegt eine Vollendung, die man nie erreicht, wenn man sich das noch so schön vorher ausmalt und hinterher mit mehreren Arbeitsgängen ausarbeitet. In diesem Bild steckt so viel von dem drin, worüber wir gerade sprechen, dass nämlich in dieser einen Bewegung, die noch nicht vorausgeplant ist und die einfach nur möglichst im Einklang mit sich und der Situation ist, eine Perfektion entsteht, ähnlich perfekt oder ähnlich eindringlich oder klar wie eine komponierte Melodie.

Somewhere over the Rainbow
Keith Jarrett
ECM 2016
Keith Jarrett. Seine Art, die Achtel zu spielen, ist unverkennbar, diese Rubato-Achtel, die doch vorwärts gehen, aber immer ein bisschen klassisch anverwandt phrasiert sind. Harmonisch geht es bei ihm immer um Vorhalte und deren Auflösung zur Terz. Und dann dieser hymnische Erzählton! Wichtig für diese Art zu spielen ist immer der Sound. Wenn es nicht in einer Philharmonie aufgenommen ist, dann halt in einem Raum, der so klingt wie ein sehr großer Raum. Wenn man so auf einem Clubklavier spielen würde, wäre das wahrscheinlich sehr gewollt. Aber in so einem akustischen Umfeld schwingt das alles und trägt. Jarrett hat ja quasi eigenhändig das Solokonzert zu dem gemacht, was es heute ist, mit diesem freien, langen Improvisieren und Fantasieren. Ohne diesen Rahmen zu kennen oder das gehört zu haben, hätte ich nie ein Solokonzert spielen können. Das ist schön, jetzt haben wir angefangen mit Gary und hören auf mit Keith.








