„Schaun wir mal, was passiert“, sagt Johannes Moser erwartungsvoll, als wir uns in seiner Wohnung in Wilmersdorf treffen. Der 32-jährige gebürtige Münchner, der als Student nach Berlin kam, ist einer der gefragtesten Cellisten weltweit. Im September 2011 hat er nun auch bei den Berliner Philharmonikern debütiert.
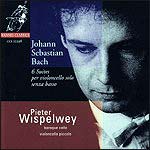
Bach: Suite Nr. 6 D-Dur Prelude
Pieter Wispelwey (Violoncello) 1998
Channel Classics
Super! So sauber und klar habe ich ein Cello mit Darmsaiten noch nie gehört. Komischerweise macht er auf einigen Tönen ein Vibrato, ein absoluter Purist kann es nicht sein. Vielleicht holt ihn da seine romantische Vergangenheit ein, aber das stört mich gar nicht. Mich freut, dass es endlich mal auf einem Fünfsaiter gespielt wird. Auf einem Viersaiter muss man die E-Saite mit dem Daumen imitieren, das wird meist intonatorisch falsch und klingt schwer. Mit einem Fünfsaiter klingt es natürlich, die E-Saite hat ja ihren ganz eigenen, quietschenden, quengeligen Charme. Ich habe ein Barockcello hier und weiß, wie schwer es ist, Darmsaiten zum Schwingen zu bringen. Aber im Konzert spiele ich ein modernes Cello. Es gibt mittlerweile so viele gute Leute auf diesem Gebiet – warum soll ich da dilettieren? Die beiden letzten Bach-Suiten gehören zu den wenigen Werken aus dem Standardrepertoire, die ich noch nicht gespielt habe. Man muss sich Dinge aufheben. Ich finde aber auch, man kann sehr gut ein Profi-Cellistenleben führen, ohne je alle sechs Bach-Suiten gespielt zu haben. Ich spiele Bach immer als Zugabe, vorzugsweise die langsamen Sätze, um den Raum auf Normaltemperatur herunterzukühlen.

Webern: Drei kleine Stücke für Violoncello solo op. 11
Thomas Demenga (Violoncello) 2004
ECM
Das war sehr langsam. Es ist perfekt gespielt – aber für mich zu perfekt. Diese Aufnahme ist nicht angreifbar, aber ob sie sinnvoll ist, ist die andere Frage. Die Faszination dieser Stücke liegt nicht nur in dem, was gespielt wird, sondern fast noch mehr in den Pausen. Wenn ich diese Stücke im Konzert spiele, spüre ich zunächst Befremden, Rascheln, und dann spiele ich sie meist noch mal. Dann ist die Aufmerksamkeit da, und dann werden auch die Pausen wahrgenommen. Auch das Spannungsverhältnis zwischen den einzelnen Stücken ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das auf CD macht… Dass diese Stücke noch immer dem großen Publikum fremd sind, liegt an der Entwicklung der Laienmusik. Im 19. Jahrhundert wurde Musik nicht nur gehört, man hat sich mit ihr beschäftigt. Diese direkte Identifizierung ist weggefallen. Den Luxus, auch die visuellen Schönheiten einer Boulez-Partitur zu genießen, haben nicht viele Leute im Publikum. Dabei sind Schönberg und Webern noch dem Wiener Schmäh verhaftet, das ist lebendige Musik. Vielleicht hat mich auch das Abstrakte an der Aufnahme gestört… Wenn ich mir das Programm dieser CD anschaue, kann ich mir vorstellen, dass das im Konzert ein Hit ist. Aber setze ich mich zu Hause hin und höre das auf CD?
 Schnittke: Menuett für Streichtrio
Schnittke: Menuett für Streichtrio
Gidon Kremer (Violine)
Ula Ulijona Zebriunaite (Viola)
David Geringas (Violoncello) 2007
aus: Celebrating Slava!
Profil Edition Günter Hänssler
Ich kenne das Stück nicht, aber ich würde auf Schnittke tippen. In einer Gruppe von 30 Leuten braucht der eigene Vater nur ein Wort zu sagen, und man hört ihn heraus. So geht es mir auch mit David Geringas, das merke ich sofort im Bauch. Er hat einen ganz eigenen Ton. Die Art, wie er die Akkorde arpeggiert, die Tonlichkeit gerade in den oberen Lagen, das ist absolut typisch. Ich war acht Jahre bei ihm, da ist eine sehr starke persönliche Bindung entstanden. Er ist ein wunderbarer Lehrer, und seine Celloklasse war so gut, dass man schon von der Konkurrenz her viel lernen konnte. Als wir dann von Lübeck nach Berlin kamen, gab es noch die Klasse Pergamenschikow. Hier wehte noch ein anderer Wind, das hat mich unheimlich angespornt. In beiden Klassen hat sich niemand geglichen, das ist ein Zeichen für einen guten Lehrer, dass er geschehen lässt, aber gut zu steuern weiß. Am meisten hab ich vor den Wettbewerben gelernt, das waren intensive Zeiten. In Wettbewerben gewinnt der, der die Jury am wenigsten verärgert. Dabei finde ich es erstrebenswert, wenn man polarisiert, die besten Musiker sind die, die geliebt oder gehasst werden. Als ich 2002 den Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau gewann, da konnte ich, glaube ich, gut Cello spielen, aber ich war künstlerisch nicht besonders weit. Ich hatte den Preis, fing an, Konzerte zu spielen, und merkte, ich kann jetzt auf die Suche gehen. Der Wettbewerb war ein Anfang.

Tschaikowsky: Rokoko-Variationen
Mstislaw Rostropowitsch (Violoncello)
Berliner Philharmoniker
Herbert von Karajan (Leitung) 1968
Deutsche Grammophon
Das war die erste Aufnahme dieses Stücks, die ich gehört habe. Nach wie vor unschlagbar, auch was die Spielfreude angeht. Man spürt selbst auf den Aufnahmen diesen unglaublichen Energiefluss, dem man sich nicht entziehen kann, auch wenn man anderer Meinung ist. Beim Dvořák -Konzert zum Beispiel wird seine Aufnahme oft als Tradition angeführt, auch von Dirigenten, was Rubati und anderes betrifft. Das ist zweifelsohne ein Meilenstein der Plattengeschichte, aber der Text verrät mir persönlich anderes. Und ich finde dieses Argument der Tradition schrecklich. Ich habe mir sogar auferlegt, keine Aufnahmen mehr zu hören, weil ich finde, man lässt sich davon zu sehr beeinflussen. Mein Vater ist Cellist, Rostro wurde zu Hause am meisten gehört. Ich spiele die Rokoko-Variationen ganz anders, auch weil mein Verständnis von Rokoko ganz anders ist – Wieskirche, überbordend, schrecklich schön. Ich bin sicherlich mehr Bauhaus als Wieskirche. Ich finde, eine Interpretation kann keine zeitlose Gültigkeit beanspruchen. Karajan und Rostro haben diesen 60er/70er Jahre-Sound geprägt. Heute spielen die Leute anders, aber auch der Zeit verhaftet. Wenn wir in 50 Jahren Harnoncourt hören, werden wir sagen: Das ist aber Old School! Was gibt es schöneres als eine lebendige Kunst?! Man beklagt sich immer über die Gefahr der Musealisierung der klassischen Musik. Aber eigentlich wird die gebannt durch zeitgemäße Interpretationen.

Brahms: Cellosonate Nr. 2 F-Dur op. 99
Pablo Casals (Violoncello)
Mieczyslaw Horszowski (Klavier) 1936
Naxos Historical
Wow! Da hat Brahms noch geblättert… Aber ein gutes Cello hat er gehabt… Wo wir gerade von Kindern ihrer Zeit sprechen – das resultiert aus einem ganz anderen Sonatenverständnis. Ich sehe Brahms absolut sinfonisch, sehe die Schönheit der Form, das kommt hier überhaupt nicht zum Tragen. Auch das Tonideal hat sich, gelinde ausgedrückt, verändert. Ich würde mal auf Casals tippen. Casals ist für mich ein schwieriges Thema. Für viele ist er ein Cellogott, und das kann ich nur für eine Aufnahme bestätigen, nämlich fürs Dvořák -Konzert, wo er schon in den 20er Jahren sehr glatte Tempi macht und nicht überall ein Rubato, wie es später üblich wurde. Aber in den Bach-Suiten liegen Betonungen immer auf der falschen Zeit, die Intonation ist schlecht, es ist nicht klangschön, auch der Brahms hier nicht. Bei Geigern aus dieser Zeit offenbart sich so ein Kreisler-Charme, dem man sich nicht entziehen kann. Aber die Geiger waren uns immer technisch voraus, erst in den letzten 30 Jahren haben die Cellisten auf breiter Basis aufgeholt, die Ausbildung ist einfach so gut geworden. Wollen wir mal in den zweiten Satz reinhören? Nein, allein schon auf diesem langen Ton würde man heute sehr viel entwickeln. Diese Aufnahme enttäuscht mich.

Friedlander: Sainted
Erik Friedlander (Violoncello)
Andy Laster (Altsaxophon) 2002
aus: Quake
Cryptogramophone
Das ist der Traum, dass man sich dem Jazz so zuwenden kann. Es ist schön, einen zu hören, der sich auskennt mit Skalen. Was ich im Duo mit der Toy Pianistin Phyllis Chen aus New York mache, ist überwiegend improvisiert, aber kein Jazz, sondern eher eine Art Ambient Music. Mich hat fasziniert, wie angenehm es ist, spielerisch mit Musik umzugehen. Das hatte sich bei mir etwas verloren durch den Zwang, jede Woche etwas anderes zu spielen – die dunkle Seite des professionellen Musikmachens. Man nimmt sich nicht mehr so viel Zeit, Musik zu machen, sondern denkt mehr daran, wie man Musik präsentiert. Insofern war diese New Yorker Erfahrung für mich sehr wichtig. Ich habe gemerkt, ich hatte etwas vernachlässigt, was mir sehr wichtig ist: der spielerische Umgang mit Klang. Aber dass ich Profi-Musiker geworden bin, habe ich nie bereut. Dieser Beruf fordert einen auf so vielen Ebenen, von der Analyse über die manuelle sportliche Herausforderung bis zur Aufgabe, all das in eine Performance zu verwandeln. Ich genieße den Beruf, ich genieße es noch immer, da zu sitzen und auf den Einsatz zu warten.






